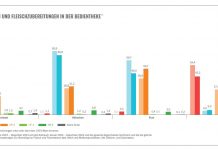Von Fides Marie Lenz, LWK Nordrhein-Westfalen
Probleme durch einen vollgekoteten oder vollurinierten Schwanz können tierschutzrelevant werden, sei es durch Entzündungen oder den Befall durch Fliegenmaden und -larven. Gleichzeitig beobachten Praktiker bei langen Schwänzen die für das Tier schmerzhafte Problematik von Schwanzbrüchen.
In Deutschland sah der letzte Entwurf zur Novellierung des Tierschutzgesetzes ein Kupierverbot innerhalb der nächsten 8 Jahre vor. Wie es hier nun weitergeht ist noch offen. Aktuell ist in Deutschland das Schwanzkürzen bei Lämmern via Ausnahmeregelung bis zum 8. Lebenstag erlaubt. Während in Deutschland das Kupierverbot noch nicht erlassen ist, hat zum Beispiel die Schweiz schon einen Stichtag festgelegt. Ab dem 1. Februar 2040 soll es ein Kupierverbot geben.
So oder so ist es jedoch sinnvoll, Alternativen zum Kupieren des Schwanzes zu etablieren. Das Tierwohlkompetenzzentrum (TWZ) Schaf hat drei Jahre mit 25 Betriebe und 12 Schafrassen intensiv an der Thematik gearbeitet. Die Projektleitung liegt beim Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen.
Das TWZ Schaf hat die Tiergesundheit bei unkupierten Schafen genauestens erfasst und auf einem Infotag in Haus Düsse vorgestellt. Kernthemen waren die enge Zusammenarbeit mit dem bestandsbetreuenden Tierarzt und eine bedarfsgerechte Schwanzschur sowie die Ausrichtung des Managements ganz klar auf Durchfallprophylaxe.
Die Auswertungen der Vagintaltupfer zeigen weniger Vaginalkeime bei Tieren mit unkupierten Schwänzen. Ein langer Schwanz hat also keine negative Auswirkung auf die Fruchtbarkeit der Schafe, sondern schützt den Vaginalbereich selbst im verschmutzten Zustand vor dem Eindringen von Keimen.
Für Tierhalter von Schafen mit langen und bewollten Schwänzen ist das Vermeiden von Durchfällen essentiell. Dazu muss der Schäfer die Fütterung, die Parasitenbekämpfung, das Weidemanagement und die Pflege der Schafe sowie eine eventuell nötige Impfprophylaxe intensiv aufeinander abstimmen.
Eine weitere Schwierigkeit für die Schafhalter ist die Schwanzschur: Viele Betriebe haben keine passende Technik und müssen Akku- Schermaschinen für eine bedarfsgerechte Schwanzschur anschaffen. Die Maschinen sind allerdings bisher fast nur im Ausland erhältlich.
Die Schafbranche muss neben den Anpassungen in der Haltung auch die Zucht auf kürzere Schwänze vorantreiben. Zwei für die Zucht relevante Parameter sehen günstig aus: Die Heritabilität – also die Erblichkeit – ist hoch und wurde je nach Rasse mit etwa 0,6 nachgewiesen. Gleichzeitig ist die phänotypische Varianz auch innerhalb der Schafrassen hoch. Dies ist eine gute Ausgangsbasis für die züchterische Bearbeitung. Eine Korrelation zwischen Körpergewicht und Schwanzlänge scheint zu bestehen, auch weitere Korrelationen zu anderen Merkmalen können nicht ausgeschlossen werden. Züchter müssen die züchterische Bearbeitung genau überwachen und begleiteten, damit sie nicht gleichzeitig negative Merkmale verstärken. Daten zu erfassen ist dabei essentiell: Jeder Züchter ist angehalten, Geburtsgewicht und Schwanzlänge zu notieren. Gebrauchshalter können dafür in Zukunft das neue Herdenmanagementtool von vit Verden nutzen, welches das TWZ Schaf entwickelt hat. Da die Rassen ohnehin schon nur in geringen Populationen vorkommen, müssen Schafhalter auch einen genetischen Verlust verhindern. In ersten Versuchen zeigte sich bereits, dass durch gezielte Anpaarung von Tieren mit kürzeren Schwänzen – verglichen mit den anderen Tieren der Herde – eine Verschiebung zum vorherigen Mittelwert nach einer Generation möglich ist. Bei einem Versuch am Oberen Hardthof in Hessen ließ sich dadurch bei Merinolandschafen schon ein im Durchschnitt 1 cm kürzerer Schwanz erreichen.
Zuerst erschienen im E-Magazin „Der Hoftierarzt“ 4-2025