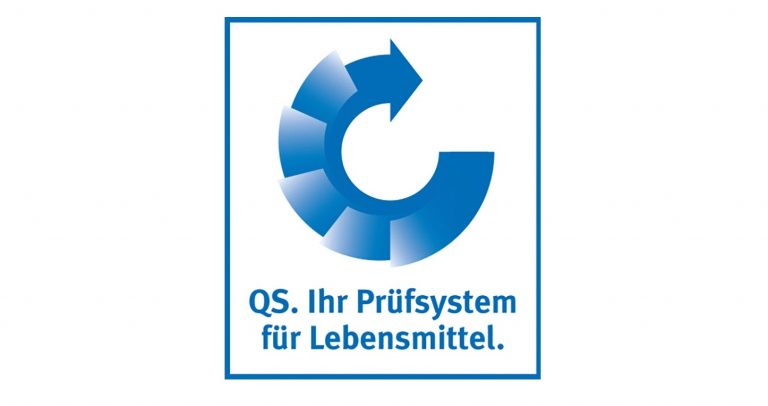Von Prof. Reinhard Puntigam, FH Soest und Dr. Julia Slama, Uni Rostock
Die nachhaltige Tierernährung fußt auf den Säulen der Ökonomie, Ökologie sowie der Gesundheit und des Wohlergehens und hat zum Ziel, diese bestmöglich und gleichermaßen zu berücksichtigen. Dazu stehen eine Vielzahl an Strategien der Rationsgestaltung zu Verfügung, die in den vergangenen Jahren stark im Fokus zahlreicher praktischer und wissenschaftlicher Untersuchungen standen. Dabei soll dem Anspruch der Verbraucher:innen ebenso nachgekommen werden, wie auch rechtlichen Vorgaben um die Eigenversorgung an hochwertigen Lebensmitteln gewährleisten zu können – somit Pflicht und Recht.
Neben dem Aspekt der Umweltwirkung rückt die Konkurrenz zwischen Teller und Trog (= Nahrungsmittelkonkurrenz) immer stärker in den Fokus der gesellschaftlichen Diskussion. Vor allem in Trögen von Schweinen finden sich bis zu zwei Drittel an Futtermittel wieder, die ebenfalls potentiell human verzehrbar wären, somit auch auf unserem Speiseplan stehen könnten. In diesem Zusammenhang leistet der gezielte Einsatz von Nebenprodukten der Lebensmittelbe- und -verarbeitung einen oftmals unterschätzten Wert. Zum einen weisen z.B. Nebenprodukte der Müllerei, Brauerei, Zuckerherstellung (Nachmehle, Kleien und Schalen, Trester und Treber, etc.) keinen oder einen kaum human verwertbaren Anteil auf. Zum zweiten ist es der Mehrwert an Nährwert, den der meist hohe Gehalt an Faser dieser Futtermittel als positiven Effekt auf Tier und Umwelt mit sich bringt. Die vielfältigsten Wirkungsmechanismen der faserreichen Nebenprodukte werden entlang des Verdauungstraktes von Schweinen entfaltet, wobei es kleine Ursachen mit großer Wirkung sind, die folgend näher beleuchtet werden sollen.
Faser physiologisch definiert
Faser (in der Humanernährung als Ballaststoffe bezeichnet) stellt eine heterogene Gruppe von Kohlenhydraten dar, die als Bestandteil eines Futtermittels durch körpereigene Enzyme nicht verdaut werden kann. Diese speziellen Verbindungen können jedoch zum Teil im hinteren Verdauungstrakt von Mikroorganismen „geknackt“ werden, wodurch neben mikrobiellem Wachstum auch Fermentationsprodukte entstehen.
Somit ist vorerst ausschließlich „Ballast“ vorhanden, dessen nährstofflicher / energetischer Nutzen bis zum Ende des Dünndarms, dem Hauptort der Nährstoffverdauung und -aufnahme (Protein, Fett, Stärke…) vernachlässigbar ist. Die im Dickdarm gebildeten Fermentationsprodukte, kurzkettige flüchtige Fettsäuren (FFS), welche im Zuge der Fermentation entstehen, können jedoch als Energiequelle genutzt werden. Neben der Fermentierbarkeit der Faser nimmt dabei speziell die Größe des „Fermenters“ eine entscheidende Rolle ein. Je größer desto mehr – so steigt das Potential zur Bildung von FFS vom Saug- über das Aufzuchtferkel, bis hin zu Mastschwein und der ausgewachsenen Zuchtsau wobei nennenswerte Energiebeiträge auf Grund der Fermentation geleistet werden können. Le Goff und Noblet (2001) haben sich als wenige dieser spannenden Frage gewidmet und die Höhe der energetischen Nutzeffizienz der Faser in Abhängigkeit des Tieralters (bzw. deren Größe) herausgearbeitet. Faser liefert zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Lebens einen unterschiedlichen energetischen Beitrag und eröffnet damit ein spannendes Forschungsfeld der Zukunft. Speziell die gebildete Buttersäure (Butyrat) wird als wichtige Energiequelle für die Zellerneuerung im Darm genutzt. Buttersäure fördert die Zellteilung und das Wachstum neuer Zellen und unterstützt damit die Aufrechterhaltung einer gesunden Darmschleimhaut. Darüber hinaus trägt Butyrat zur Stärkung der Darmbarriere bei, wirkt entzündungshemmend und schützt das Darmepithel z.B. vor pathogenen Keimen. Eine Vielzahl an Studien unterstreicht die positive Wirkung. Durch die gezielte „Fütterung“ der Mikrobiota mit Faser, sogenannte Prebiotika, kann ein Darmmillieu geschaffen bzw. aufrechterhalten werden, welches ein ausgewogenes Verhältnis zwischen möglichen pathogenen Keinem und positiven Mikroorganismen hervorruft und somit einer möglichen „Dysbiose“, einem Ungleichgewicht entgegenwirkt. Nicht zuletzt entstehen neben Butter- auch Propion- und Essigsäure, die das Darmmilieu ansäuern und damit das Wachstum pathogener Keime hemmen.
Faser analytisch definiert
Die klassische Bestimmung der oft genannten Rohfaser (XF, damals Holzfaser) geht auf Henneberg und Stohmann (1860) zurück und stellt den „unlöslichen“ (manches geht dennoch in Lösung) Rückstand (Cellulose, Hemicellulose, Lignin) unter Einwirken von Säuren und Laugen im Zuge der Weender Analyse dar. Auch aktuell ist der Gehalt an Rohfaser eines Futtermittels im Zuge der Rationskalkulation und Deklaration das Mittel der Wahl, wenngleich kein direkter Zusammenhang zwischen dem Gehalt an Rohfaser und dem fermentierbaren Anteil an Faser herrscht. Da über den Parameter Rohfaser allein keine ausreichende Bewertung der Faserversorgung von Schweinen gegeben ist, rückt eine genauere Charakterisierung anhand der sogenannten Gerüstsubstanzen (NDF, ADF, ADL) in den Vordergrund.
Damit wird eine Differenzierung in Zellulose, Hemizellulosen und Lignin möglich gemacht und lässt auch erste Rückschlüsse auf die Fermentierbarkeit der Faser zu. Jedoch reichen auch NDF und ADF für entsprechende Empfehlungen zur Versorgung nicht aus, da die Eigenschaften der Faser wesentlich komplexer sind. Die enzymatische Bestimmung der Ballaststoffe (TDF, total dietary fibre oder auch Gesamtfaser), wie sie für die Humanernährung verwendet wird, lässt demgegenüber noch einen tieferen Blick zu. Neben dem Gesamtgehalt an Faser (TDF) kann ebenfalls eine Differenzierung in lösliche (SDF) und unlösliche (IDF) Anteile vorgenommen werden, wodurch eine genauere Abschätzung der Fermentierbarkeit ermöglicht wird. Es gilt: Je löslicher, desto besser fermentierbar. Tabelle 1 stellt die chemische Charakterisierung ausgewählter Faserfuttermittel dar und unterstreicht den Unterschied der jeweiligen Analyse.
Zuerst erschienen im zweimonatlichen Hoftierarzt E-Magazin. Zum kostenfreien Newsletter-Abo bitte einfach hier anmelden und dann den Link in der Bestätigungs-Mail anklicken. Anschließend den ganzen Artikel in der letzten Ausgabe weiterlesen: