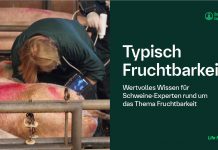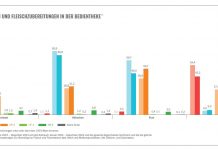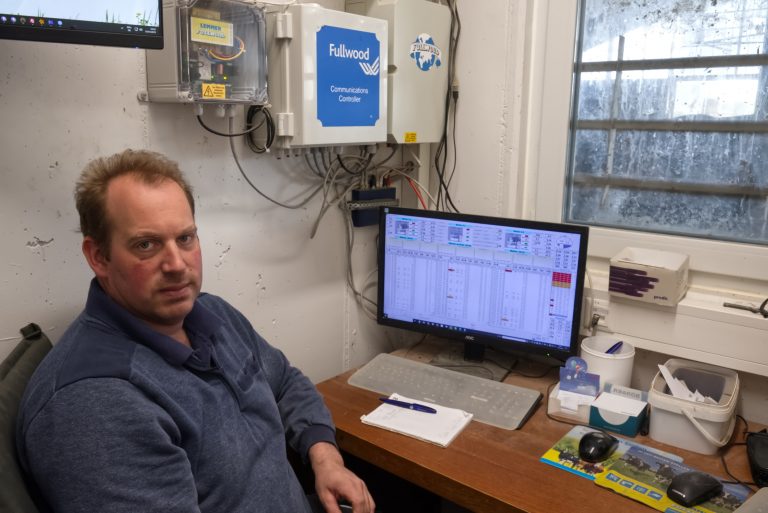Ministerium folgt einem Beschluss des Niedersächsischen Tierschutzplans für nachhaltige Nutztierhaltung
In naher Zukunft soll die Anbindehaltung von Rindern in Niedersachsen der Vergangenheit angehören. Das Vorhaben haben heute das niedersächsische Landwirtschaftsministerium (ML) gemeinsam mit Vertretern des Landvolks, des Landestierschutzverbandes Niedersachsen und der Landesbeauftragten für den Tierschutz in einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt.
Basierend auf einer Beschlussvorlage der Facharbeitsgruppe Rinder des Niedersächsischen Tierschutzplans für nachhaltige Nutztierhaltung wurde ein an die kommunalen Veterinärbehörden gerichteter Erlass erarbeitet, mit dem die Anbindehaltung von Rindern in Niedersachsen grundsätzlich zu untersagen ist. Dem vorgeschaltet hat das ML gestern die Anhörung der Kommunalen Spitzenverbände gestartet.
Deutschlandweit werden noch immer mehr als eine Million Rinder in landwirtschaftlichen Betrieben im Stall angebunden gehalten. Auch in Niedersachsen existieren nach Kenntnis des ML noch deutlich mehr als eintausend Betriebe, in denen Rinder über mehrere Monate im Jahr oder über mehrere Stunden am Tag in Anbindehaltung gehalten werden. Diese Haltungsform ist mit den im Tierschutzgesetz normierten Anforderungen nicht vereinbar: Demnach muss ein Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend verhaltensgerecht untergebracht werden. Ferner ist es nicht zulässig, die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung so einzuschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden. Das natürliche Verhalten von Rindern wird in der Anbindehaltung stark eingeschränkt und teilweise sogar gänzlich unterdrückt.
Im Jahr 2011 hatte der Leitungsausschuss des Tierschutzplans unter Landwirtschaftsminister Gert Lindemann (CDU) das Ziel des Ausstiegs aus der Anbindehaltung beschlossen. 2018 wurde zunächst ein Erlass auf den Weg gebracht, der vorgab, dass zumindest weiblichen Rindern in Anbindehaltung ganzjährig täglich mindestens zwei Stunden Auslauf oder während der Vegetationsperiode von Mai bis Oktober täglich Weidegang von mehr als zwei Stunden gewährt werden muss. Aufgrund einer im Jahr 2024 erfolgten Abfrage bei den Veterinärämtern der Landkreise und kreisfreien Städte hat das ML Kenntnis darüber, dass es in Niedersachsen höchstwahrscheinlich noch Betriebe gibt, die – möglicherweise aus Unkenntnis – Rinder nach wie vor ganzjährig ohne zweistündigen Auslauf angebunden halten.
Mit dem heutigen Tag wird ein vollständiges Ausstiegskonzept für das Ende der Anbindehaltung bei Rindern vorgestellt.
Eckpunkte zum Ausstieg aus der Anbindehaltung – Übergangsfristen nach Form der Haltung differenziert
Betriebe, die ihren Rindern gar keinen Auslauf ermöglichen und sie ganzjährig in Anbindehaltung halten, müssen sich binnen eines Zeitraumes von sechs Monaten ab Bekanntgabe einer Allgemeinverfügung der Landkreise und kreisfreien Städte bei ihrer zuständigen Veterinärbehörde melden und mitteilen, ob sie beabsichtigen, die Rinderhaltung auf ein anderes Haltungssystem umzustellen oder die betroffene Rinderhaltung aufzugeben. Für diese Betriebe wurde eine Übergangsfrist von 18 Monaten festgelegt. Binnen dieser Zeit müssen sie die Anbindehaltung umbauen oder diese Form der Tierhaltung beenden.
Betriebe
* mit kombinierter Anbindehaltung (mit ganzjährig täglichem mindestens zweistündigem Auslauf),
* saisonaler Anbindehaltung (Weide von Mai bis Oktober) oder
* mit Anbindehaltung männlicher Mastrinder (dürfen ab dem sechsten Lebensmonat für längstens sechs Monate ihrer Lebenszeit angebunden gehalten werden)
müssen sich binnen eines Zeitraumes von drei Jahren ab Bekanntgabe einer Allgemeinverfügung der Kommune bei ihrer zuständigen kommunalen Veterinärbehörde melden und mitteilen, ob sie beabsichtigen, die Tierhaltung umzubauen oder die Rinderhaltung gänzlich einzustellen.
Spätestens mit Ablauf einer Frist von sieben Jahren ab Bekanntgabe der Allgemeinverfügung muss der Umbau abgeschlossen sein.
Diese Frist kann im begründeten Einzelfall, beispielsweise bei Verzögerungen im Genehmigungsverfahren, welche vom Tierhalter nicht zu verschulden sind, um weitere zwei Jahre verlängert werden.
Betriebe mit den oben genannten Haltungsformen (saisonale, kombinierte oder Anbindehaltung von männlichen Mastrindern), die ihrer Meldepflicht nicht nachkommen oder beabsichtigen, die Rinderhaltung aufzugeben, müssen diese mit Ablauf von fünf Jahren ab Bekanntgabe der Allgemeinverfügung beenden. Innerhalb der Umstellungs- und Übergangsfristen sind spezielle Mindestanforderungen, beispielsweise an die Anbindevorrichtungen und die Ausgestaltung der Stand-/Liegeflächen, einzuhalten.
Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte: „Das Leid der Rinder, die in Anbindehaltung gehalten werden, muss endlich beendet werden. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, einen Ausstiegsplan vorzulegen, der sowohl von Seiten der Landwirtschaft als auch von Tierschutzverbänden erarbeitet wurde. In der Anbindehaltung verbringen Rinder ihr Dasein mit einer Kette um den Hals fixiert in einem knapp über einem Meter breiten Stand, Seite an Seite und nahezu bewegungsunfähig mit ihren Art- oder besser Leidensgenossen. Das entspricht etwa der Größe eines Billardtischs. Diese Form der Nutztierhaltung ist seit Jahren aus Gründen des Tierschutzes untragbar, da sie die wesentlichen arteigenen Verhaltensweisen – insbesondere das Bewegungs-, Sozial- und Komfortverhalten – der Rinder erheblich einschränkt. Vor dem Hintergrund einer mittlerweile jahrzehntelangen Debatte gehen wir in Niedersachsen zum Wohl der Tiere einen eigenen Weg, um langfristig die Anbindehaltung von Rindern zu beenden.“
Landesbeauftragte für den Tierschutz, Julia Pfeiffer-Schlichting: „Alle Formen der Anbindehaltung – ganzjährige, saisonale, mehrmonatige und kombinierte – sind nicht angemessen verhaltensgerecht im Sinne des § 2 Nr. 1 Tierschutzgesetz. Auslegungsmaßstab ist die vergleichende Verhaltensforschung bzw. Ethologie. In Anbindehaltung können sich Rinder weder fortbewegen noch umdrehen, ja nicht einmal vernünftig kratzen. Ihr Leben ist reduziert auf Stehen, Liegen, Fressen und Ausscheidung. Die Rinder sind nicht in der Lage, ihre artgemäßen Bedürfnisse zu befriedigen, dies ist nicht nur eine Belastung für ihren Körper, sondern vor allem für ihr psychisches Wohlbefinden. Ich bin froh, dass sich viele meiner Berufskolleginnen und -kollegen Anfang des Jahres öffentlich für ein Ende der Anbindehaltung ausgesprochen haben und Niedersachsen diesen Schritt nun geht, auf den wir auf Bundesebene so lange vergeblich warten.“
Frank Kohlenberg, Vizepräsident des Landvolks Niedersachsen: „Der Landesbauernverband begleitet den Ausstieg aus der Anbindehaltung kritisch, steht aber im Ergebnis klar hinter diesem Schritt. Entscheidend ist für uns, dass der Wandel praxisnah und mit Augenmaß erfolgt. Wir zeigen konkrete Lösungsansätze auf und verstehen uns dabei als konstruktiver Partner der Politik und der Betriebe. Für die betroffenen Landwirte ist vor allem eines unverzichtbar: Planungssicherheit. Der Umbau zur Laufstallhaltung braucht lange, verlässliche Zeitfenster und realistische Übergangsfristen. Ohne ausreichende finanzielle Förderung wird der Ausstieg nicht gelingen – notwendig sind Mittel für Beratung, baurechtliche Verfahren und den eigentlichen Umbau. Wir begleiten den Erlass als Lösungsanbieter und setzen uns dafür ein, dass das Baurecht so angepasst wird, dass Landwirte schnell und unbürokratisch investieren können. Gleichzeitig halten wir eine umfassende Folgenabschätzung für unerlässlich – wirtschaftlich wie gesellschaftlich. Nur wenn die Maßnahmen tragfähig sind, bleibt auch die Tierhaltung in unserer Region zukunftsfähig.“
Dieter Ruhnke, Vorsitzender Landestierschutzverband Niedersachsen: „Nachdem auf Bundesebene schon in der letzten Bundesregierung ein Verbot der Anbindehaltung mutlos ausgesessen wurde, ist auch bei dem aktuellen Bundeslandwirtschaftsminister ein Ausstieg aus der Anbindehaltung ausgeschlossen. Da in Niedersachsen nach einer Erhebung weit mehr Betriebe als vermutet mit einer Anbindehaltung von Rindern verortet sind, war es aus unserer Sicht nur konsequent, die Thematik in den Niedersächsischen Tierschutzplan für nachhaltige Nutztierhaltung einzubringen, um einen gemeinsamen Weg zum Ausstieg aus der Anbindehaltung auf Landesebene in Niedersachsen zu finden. Die Anbindehaltung stellt einen klaren Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar. Aus diesem Grund ist der Ausstieg aus der Anbindehaltung dringend geboten, zumal diese Haltungsform bei anderen Tierarten schon lange verboten ist. Neben der Tatsache, dass die Anbindehaltung eine völlig veraltete Haltungsform darstellt, verschafft sie darüber hinaus den Tierhalterinnen und Tierhaltern, die ihre Rinder nach wie vor in dieser Form halten, durch die kostengünstige Haltung gegenüber tierschutzgerechteren Haltungsformen einen persönlichen wirtschaftlichen Vorteil – ein Wettbewerbsvorteil auf Kosten der Tiere. Als Landestierschutzverband sind wir diesmal mit unserer Zustimmung mehr als einen Schritt auf die Tierhalterinnen und Tierhalter zugegangen und haben auch die langen Bearbeitungszeiten von Bauanträgen für Umbaumaßnahmen mitberücksichtigt, damit zumindest in Niedersachsen die ersten Schritte zum Ausstieg aus der Anbindehaltung für Rinder eingeleitet werden können.“
Frauke Patzke, Agrarstaatssekretärin und Vorsitzende des Leitungsausschusses des Niedersächsischen Tierschutzplans für nachhaltige Nutztierhaltung: „Mit unseren langen Übergangs- und Umstellungsfristen lassen wir umbauwilligen Tierhalterinnen und Tierhaltern ausreichend Zeit für die Planung und Umsetzung ihrer zukünftigen Tierhaltung. Die Finanzierung ist hierfür natürlich ein maßgeblicher Faktor, das ist uns bewusst. Für Beratung und für Investitionen stellen wir Fördermittel bereit. Betriebe, die die Tierhaltung abbauen und Einkommensalternativen schaffen wollen, können aus der Diversifizierungs-Richtlinie gefördert werden. Stallneubauten oder -umbauten werden über das Agrarinvestitionsförderungsprogramm unterstützt. Hier werden Betriebe, die die Anbindehaltung beenden, im Ranking besonders berücksichtigt.“
Hintergrund
Der im Jahr 2024 vom Bundeslandwirtschaftsministerium vorgelegte Referentenentwurf zur Änderung des Tierschutzgesetzes sah unter anderem auch Regelungen zur Anbindehaltung vor. Mit dem Regierungswechsel im letzten Jahr ist der Änderungsentwurf der Diskontinuität anheimgefallen. Mit seinem Vorstoß setzt Niedersachsen gegenüber dem Bund ein Zeichen und fordert ein bundesweites Ende der tierschutzwidrigen, nicht mehr zeitgemäßen Anbindehaltung von Rindern.
Insgesamt gab es im Mai 2025 in Niedersachsen 17.969 rinderhaltende Betriebe mit 2.205.693 Tieren. Insgesamt gibt es in Niedersachsen nach Schätzung des ML deutlich mehr als 1.000 Betriebe, die Rinder in Anbindehaltung halten. Hierbei handelt es sich eher um unterdurchschnittlich große Betriebe.
Quelle: Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz