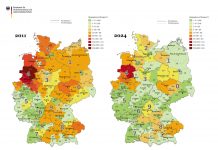Carolina Sophia Heide, Tierärztin am ITTN der Tierärztlichen Hochschule Hannover, widmete Ihren Vortrag auf der diesjährigen Tierschutztagung dem Thema „Mobile Geflügelschlachtung“. Einleitend zählte sie deren Vorteile auf:
• vollmobile Schlachtung (mobiler Anhänger)
• Vermeidung von Transport
• schonendes aufrechtes Fangen
• kurze Warte- und Nüchterungszeiten
• Stressminimierung
• Minimierung von Transport-Verletzungen und -Verlusten
Grundsätzlich ist die mobile Geflügelschlachtung mit und ohne EU-Zulassung möglich. Ohne EU-Zulassung dürfen bis zu 10.000 Tiere pro Jahr und Betrieb geschlachtet werden. Die Einheiten sind bei der zuständigen Behörde zu registrieren und es dürfen nur eigene Tiere im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb geschlachtet werden.
Der Tierhalter ist verantwortlich für die gesamte Lebensmittelkette, also Schlachtung, Kühlung, Lagerung und Vermarktung des Geflügels. Will der Tierhalter sein Geflügel an den Einzelhandel abgeben, ist zweimal jährlich eine Schlachtuntersuchung durch die zuständige Behörde vorgeschrieben. Will er das Fleisch jedoch nur an Endkunden abgeben, muss diese Untersuchung nicht stattfinden.
Das Fleisch ist nach der Schlachtung unverzüglich auf 4 Grad Celsius herunterzukühlen, die Reinigung und Desinfektion des Anhängers sollte in Eigenkontrollunterlagen protokolliert werden. Eine Erfolgskontrolle ist jedoch nicht vorgeschrieben und Endprodukt darf direkt an den Endkunden oder den Einzelhandel im Umkreis unter 100 Kilometer vermarktet werden. Es ist eine Grobzerlegung möglich, aber keine Weiterverarbeitung des Fleisches in EU zugelassenen Verarbeitungsbetrieben.
EU-zugelassenen Schlachtmobile sind quasi vollwertige Schlachthöfe auf Rädern. Deswegen gelten entsprechend auch alle einschlägigen EU-Verordnungen (852/2004, 853 2004, 1099/2009). Es dürfen mehr als 10.000 Tiere pro Betrieb im Jahr geschlachtet werden und in der Regel ist immer ein Amtsveterinär oder ein amtlicher Tierarzt vor Ort, um die Lebendtier- und Fleischuntersuchung durchzuführen. Das ermöglicht es auch Kleinstgruppen – Tiere aus verschiedenen Betrieben – zu schlachten.
Bei der EU zugelassenen Schlachtung ist die Vermarktung über 100 Kilometer uneingeschränkt möglich und das Fleisch darf an Fleischverarbeitungsbetriebe zur Produktion von z. B. Hühnerfrikassee oder Wurst abgegeben werden, was Vermarktungsmöglichkeiten auch für Legehennen bietet.
Die technischen Voraussetzungen für mobiles Schlachten sind in jedem Fall:
• ebener, befestigter Untergrund
• Trinkwasseranschluss ½ Zoll
• 16 und 32 A Starkstromanschluss
• Schmutzwasserablauf (Kanalisation)
• Gesonderte Entsorgung von Blut und Federn (Kat. 3 Material)
• Kühlmöglichkeit auf 4 Grad Celsius
• Örtliche Nähe zu Tierbeständen ist zu vermeiden
Das Personal für die mobile Geflügelschlachtung muss einen Sachkundenachweis nach Tierschutzschlachtverordnung (§ 4, Abs. 8) besitzen, gemäß § 43, Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes belehrt worden sein sowie eine Hygieneschulung nach § 4 Lebensmittelhygieneverordnung absolviert haben.
Mit vier Arbeitskräften (zwei im Schwarzbereich, zwei im Weißbereich) sind in der Regel 80 Masthühner oder 120 Legehennen pro Stunde zu schaffen. Bei großem Geflügel, z. B. Puten werden in der Regel maximal 15 Tiere je Stunde geschlachtet.
Wieviel Zeit für die Reinigung einzukalkulieren ist, hängt vom Verschmutzungsgrad der Schlachteinheit ab. Werden z. B. in den Wintermonaten viele Gänse geschlachtet, kann die Nassreinigung auch mal viereinhalb Stunden in Anspruch nehmen. Hinzu kommt noch die anschließende Abtrocknungszeit mit Desinfektion. Selbstredend sind Biosicherheit und fachgerechte Desinfektion bei der mobilen Schlachtung von zentraler Bedeutung!
Fazit:
Die mobile Schlachtung eignet sich vielleicht eher für kleinere Betriebe mit Direktvermarktung, wenn die eingangs erwähnten Vorteile den Endkunden direkt vermittelt werden können. Andererseits sinken die Einzeltierkosten bei größeren Partien, was auch für den Zusammenschluss mehrerer Betriebe sprechen könnte.