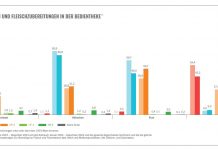Ein wirksames Vorgehen gegen Mastitis beginnt mit einer sauberen und gezielten Diagnostik. Nur wer weiß, welche Erreger im Betrieb Probleme bereiten, kann passende Behandlungen und vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Ein zentraler Bestandteil dabei ist die korrekte Entnahme von Viertelgemelksproben zur bakteriologischen Untersuchung.
Warum Milchproben untersuchen?
Euterentzündungen treten häufig auf und oft steigt gleichzeitig der Zellgehalt der Tankmilch. Eine fundierte Diagnostik beantwortet Fragen wie: Welche Erreger sind beteiligt? Soll behandelt werden und wenn ja, womit? Besonders bei erhöhten Zellzahlen, akuten Euterentzündungen oder ausbleibendem Behandlungserfolg ist eine Laboranalyse zielführend.
Milchproben richtig entnehmen – der Schlüssel zur Diagnose
Die Aussagekraft jeder Untersuchung steht und fällt mit der korrekten Probenentnahme. Optimal geeignet sind Anfangsgemelksproben aus jedem der vier Euterviertel eines Tieres. Auch wenn nur ein Viertel klinisch auffällig ist, sollten alle Viertel beprobt werden. Das erlaubt dem Labor den Vergleich gesunder und infizierter Viertel und das Aufdecken subklinischer Infektionen.
Ablauf der korrekten Probennahme:
• Vorbereitung: Probenröhrchen, 70 % Alkohol, Euterpapier oder saubere Watte bereithalten.
• Vormelken: Die ersten Strahlen jedes Viertels in einen Vormelkbecher geben, um Keime aus dem Strichkanal auszuspülen.
• Reinigung: Die Zitze mit Euterpapier säubern.
• Desinfektion: Die Zitzenkuppe mit Alkohol gründlich desinfizieren. Zuerst die am weitesten vom Melker entfernte Zitze, zuletzt die nächstgelegene Zitze desinfizieren.
• Probenentnahme: Ohne die Röhrchenöffnung zu berühren, die Probe direkt in das sterile Röhrchen melken. Zuerst die am nächsten zum Melker befindlichen Zitzen beproben, danach die entfernteren Zitzen.
• Lagerung: Proben rasch kühlen (Kühlschrank oder Gefrierfach) und zügig ins Labor schicken.
Wird dieser Ablauf nicht eingehalten, besteht das Risiko, dass Kontaminanten (z. B. Hautkeime) das eigentliche Erregerbild überlagern. Die Folge sind falsche oder unbrauchbare Ergebnisse.
In akuten Fällen: Behandeln und Beproben
Bei schweren Mastitisfällen darf die Therapie nicht verzögert werden. Trotzdem sollte die Milchprobe vor der ersten Antibiotikagabe entnommen werden. Falls dies nicht möglich war, kann auch parallel zur laufenden Behandlung beprobt werden. Bleibt der Therapieerfolg aus, hilft die Erregerbestimmung bei der Anpassung der Behandlung.
Subklinische Mastitis erkennen
Bei chronisch erhöhter Zellzahl ohne sichtbare Entzündung ist die gezielte Beprobung besonders sinnvoll. Es empfiehlt sich, mindestens zehn zellzahlauffällige Tiere (bzw. 10 % der Herde) mit Viertelgemelksproben zu untersuchen. So lassen sich subklinische Infektionen und deren Erreger gezielt identifizieren.
Antibiotikaeinsatz gezielt absichern
Die Auswahl der eingesetzten Antibiotika – auch bei Trockenstellern – sollte auf Laborergebnissen beruhen. Dies ist nicht nur therapeutisch sinnvoll, sondern auch arzneimittelrechtlich vorgeschrieben. Eine fundierte Diagnostik schützt vor unnötigem Antibiotikaeinsatz und hilft, Resistenzen zu vermeiden.
Erreger- und Resistenzbestimmung
Im Labor erfolgt die Identifikation der Erreger sowie deren Antibiotikaempfindlichkeit (z. B. mittels Plättchentest). Hierbei werden Hemmhöfe um antibiotikahaltige Testplättchen auf einem Nährboden ausgewertet. Wichtig: Die Erreger müssen vorab isoliert werden, um eine aussagekräftige Resistenzprüfung durchzuführen. Eine direkte Ausbringung der Milch auf Nährboden ist nicht zielführend, da oft Kontaminanten schneller wachsen als die Mastitis-Erreger.
Keine Behandlung ohne Diagnostik?
Ein Antibiogramm ist kein Therapieauftrag, sondern ein diagnostisches Hilfsmittel. Es zeigt, welche Wirkstoffe nicht eingesetzt werden sollten. Ob eine Behandlung notwendig ist – und wenn ja, mit welchem Präparat – muss im Einzelfall entschieden werden, idealerweise in Abstimmung mit dem Hoftierarzt.
Fazit
Eine gezielte Mastitisbehandlung beginnt im Melkstand: Nur korrekt gewonnene Milchproben erlauben eine fundierte Erregerdiagnose und ermöglichen eine verantwortungsvolle, rechtssichere und wirksame Therapie. Unsaubere Probennahmen gefährden nicht nur das Untersuchungsergebnis, sondern im schlimmsten Fall auch die Tiergesundheit. Deshalb gilt: Diagnostik beginnt mit der sauberen Probenentnahme.
Kontakt: https://www.tiergesundheitundmehr.de/ansprechpartner
Mehr zur Eutergesundheit www.ubrocare.de