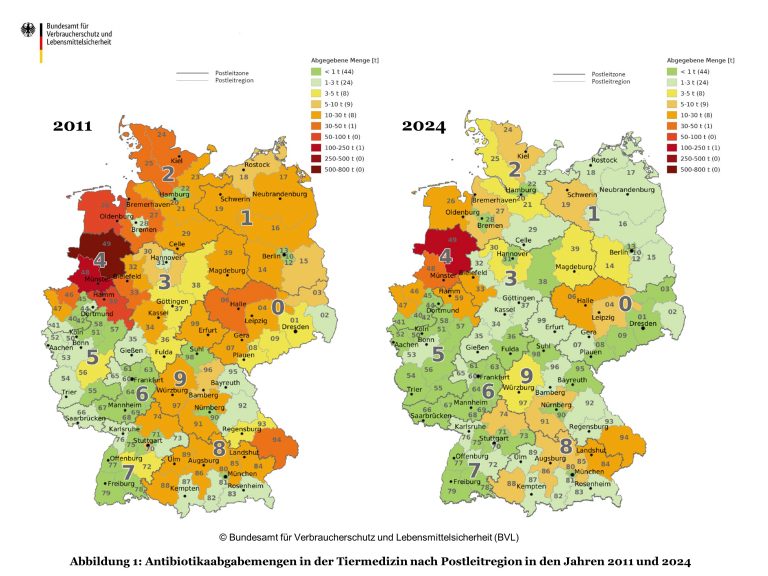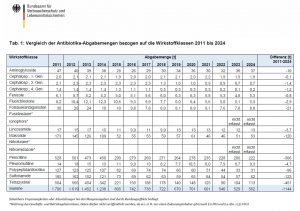Lokale Faktoren wie saisonale Temperatur, der jahresabhängige Wasser- und Vegetationsindex oder Daten zur Tierdichte können genutzt werden, um regionale Ausbrüche der Vogelgrippe in Europa vorherzusagen. Das zeigen die Arbeiten eines Forschungsteams unter Leitung des Epidemiologen, Mathematikers und Statistikers Prof. Dr. Joacim Rocklöv. Die Forscherinnen und Forscher der Universität Heidelberg entwickelten ein auf Maschinellem Lernen basierendes Modell, das anhand verschiedener Indikatoren Ausbruchsmuster der hochpathogenen aviären Influenza in Europa mit hoher Genauigkeit voraussagen kann. Der Modellierungsansatz und eine gezielte Datenerhebung könnten so einen Beitrag zu proaktiven Präventionsmaßnahmen leisten.
Die hochpathogene aviäre Influenza-Virus-Infektion – umgangssprachlich als Vogelgrippe oder Geflügelpest bezeichnet – betrifft in erster Linie Vögel. Vermehrt kommt es aber auch zu Infektionen bei Säugetieren. Dadurch steigt nach Angaben der Wissenschaftler die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus auf den Menschen überspringt. Um Ausbrüche der Vogelgrippe besser vorhersagen und ihnen frühzeitig entgegenwirken zu können, entwickelte das Team von Prof. Rocklöv am Interdisziplinären Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen und am Heidelberger Institut für Global Health ein Modell, das verschiedene Indikatoren für einen möglichen Ausbruch zusammenführt und für die Modellierung Methoden des Maschinellen Lernens nutzt.
Trainiert wurde das Modell mit Daten zu Ausbrüchen der Vogelgrippe, die zwischen 2006 und 2021 für Europa dokumentiert sind. Als potentielle Ausbruchs-Indikatoren identifizierten die Heidelberger Wissenschaftler dabei lokale Faktoren wie die Temperatur- und Niederschlagsbedingungen, die Wildvogelarten, die Dichte der Geflügelhaltung, die Beschaffenheit der Vegetation und die Wasserstände. Durch die Zusammenführung dieser komplexen, in Abhängigkeit von Jahreszeit und Region miteinander wechselwirkenden Variablen konnten die Forscherinnen und Forscher Ausbruchsmuster mit einer Genauigkeit von bis zu 94 Prozent modellieren.
„Die Kombination unseres Modellierungsansatzes mit einer gezielten Datenerhebung kann dazu beitragen, Hochrisikogebiete und Jahreszeiten, zu denen Ausbrüche der Vogelgrippe wahrscheinlich sind, genauer zu kartieren“, betont Joacim Rocklöv. Der Wissenschaftler forscht als Alexander von Humboldt-Professor in einer Reihe von Projekten an der Universität und am Universitätsklinikum Heidelberg zu Auswirkungen von Klima- und Umweltveränderungen auf die öffentliche Gesundheit. Die Forschungsergebnisse könnten nach Angaben von Prof. Rocklöv dazu genutzt werden, regionale Überwachungsprogramme in ganz Europa neu auszurichten und die Früherkennung zu verbessern.
Die Forschungsarbeiten wurden von der Alexander von Humboldt-Stiftung und der Europäischen Union im Rahmen des „Horizon Europe“-Programms gefördert. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ erschienen.
Quelle: Universität Heidelberg