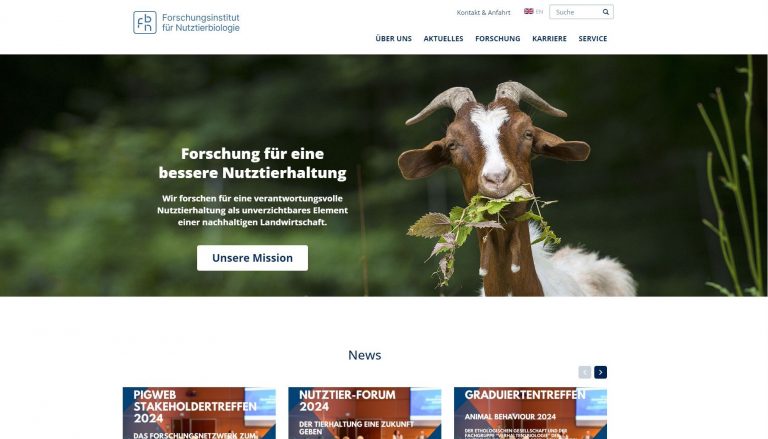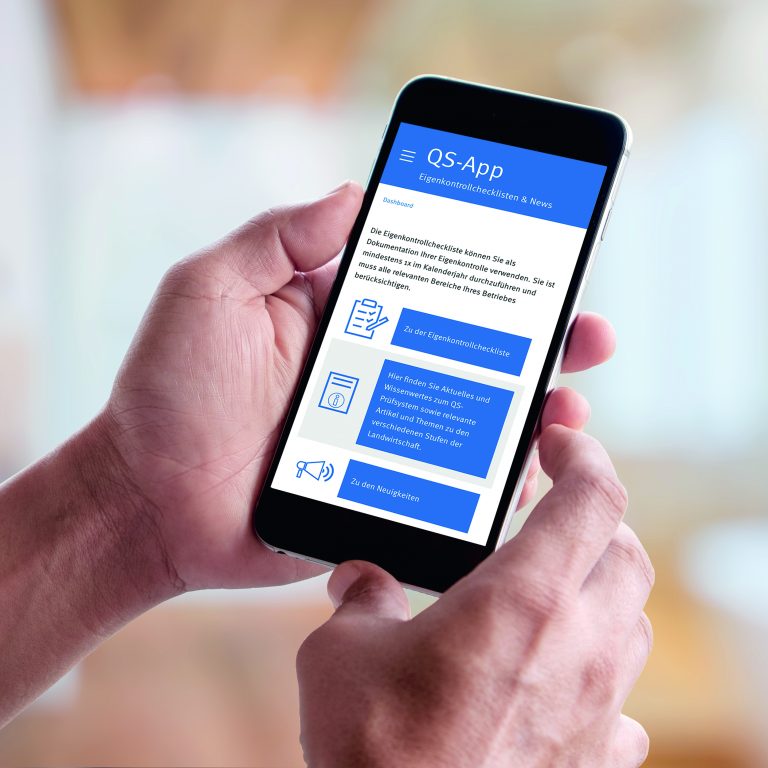Wissensvermittlung, Förderung der Nachfrage und Unterstützung durch die Politik – dies sind nach Erkenntnissen der Universität Hohenheim in Stuttgart nur einige Ansätze, um das sogenannte Kälberproblem zu lösen. Denn die zunehmende Produktion von Bio-Milch führt dazu, dass immer mehr Bio-Kälber geboren werden. Ein Zusammenhang, der vielen Menschen gar nicht bewusst ist, so das Ergebnis einer Untersuchung der Universität. Noch weniger verbreitet ist jedoch das Wissen, dass für diese Bio-Kälber so gut wie kein Markt existiert. Die Folge: Die Tiere werden größtenteils an konventionell arbeitende Betriebe verkauft. Zusammen mit der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU), haben Hohenheimer Forschende im Projekt „WertKalb“ Lösungen für dieses Kälberproblem erarbeitet.
Die Zunahme der Milchproduktion führt dazu, dass immer mehr Kälber geboren werden. Denn um kontinuierlich Milch zu geben, müssen Kühe einmal im Jahr ein Kalb zur Welt bringen. „Diese Kälber erfahren weder unter ethischen noch ökonomischen Aspekten eine Wertschätzung“, bedauert Prof. Dr. Mizeck Chagunda vom Fachgebiet Tierhaltung und Tierzüchtung in den Tropen und Subtropen an der Universität Hohenheim. Vor allem männliche, aber auch überzählige weibliche Jungtiere, die nicht zum Erhalt des Bestandes an Milchkühen benötigt werden, werden im Alter von wenigen Wochen verkauft und nach Norddeutschland oder ins Ausland transportiert, um dort gemästet zu werden. In besonderem Maß trifft dies auf ökologisch wirtschaftende Milchviehbetriebe zu: Aktuell werden auf Bio-Betrieben in Baden-Württemberg jährlich über 22.000 überzählige Kälber geboren.
Für die Tiere bedeutet dies nicht nur lange Transporte, sie verlassen in der Regel auch die regionale Bio-Wertschöpfungskette, da sie meist an konventionell arbeitende Mastbetriebe verkauft werden. Sowohl für Bio-Landwirt:innen als auch für Menschen, die Bio-Produkte kaufen, eine unbefriedigende Situation.
Suche nach Lösungsansätzen: Alle müssen an einem Strang ziehen
Nach den Erkenntnissen der Forschenden liegt die Hauptursache in der Spezialisierung der Milchviehbetriebe: „Sie hat zu einer Entkopplung des riesigen Milchmarkts und des vergleichsweise winzigen Fleischmarkts geführt: Die Nachfrage nach Bio-Milch ist ungleich höher als nach Bio-Kalb- und -Rindfleisch“, erklärt Josephine Gresham, Koordinatorin der Projektes „Innovative Strategien für eine ethische Wertschöpfung der Kälber aus der ökologischen Milchviehhaltung“, kurz „WertKalb“.
Doch wie kann dieses Problem gelöst werden? Gemeinsam mit Bio-Landwirt:innen, Bio-Verbänden, Erzeuger- und Absatzgemeinschaften und einzelnen Fachleuten entwickelten Forschende der Universität Hohenheim und der HfWU Strategien entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Milchviehhaltung – angefangen bei der Tierzüchtung über die Tierhaltung bis zur Vermarktung.
„So ein Vorhaben kann nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen und bereit sind, konstruktiv zusammen zu arbeiten“, betont Projektleiter Prof. Dr. Chagunda. Insgesamt beteiligten sich 21 Betriebe und Organisationen an dem Verbundprojekt. Der Fokus lag dabei auf den Bio-Musterregionen Ravensburg, Biberach, Hohenlohe und Freiburg.
Maßnahmen-Katalog
Die Forschenden erarbeiteten einen ganzen Katalog an Maßnahmen. Angefangen bei Wegen, erst gar nicht so viele Kälber zu erzeugen: „Wenn in rund 13 Prozent der baden-württembergischen Betriebe die Zeit zwischen den einzelnen Geburten nur um drei Monate erhöht würde, so kämen circa sieben Prozent weniger Kälber auf die Welt, ohne dass die Milchleistung wesentlich verringert wird“, so Josephine Gresham. Dies ließe sich noch steigern: „Es könnten sogar 14 Prozent weniger sein, würde die Zeit um sechs Monate erhöht.“
Es folgen Ansätze, um die Mast interessanter zu machen. Dies können unter anderem Zweinutzungsrassen sein, die sowohl Milch als auch Fleisch liefern, aber auch sogenannte Gebrauchs- oder Kreuzungszüchtungen, bei denen die Kälber schneller an Gewicht zunehmen und eine bessere Fleischqualität aufweisen. Eine stressfreie Schlachtung im Herkunftsbetrieb verbessert die Fleischqualität zusätzlich. Zum Maßnahmenkatalog: https://oekolandbauforschung-bw.uni-hohenheim.de/wertkalb_hintergrund
Jeder Betrieb muss eigenen Weg finden – Politik gefordert
„Es kann jedoch nicht eine Strategie für alle Betriebe geben, sondern jeder landwirtschaftliche Betrieb muss individuell eine für sich passende Strategie entwickeln“, fasst Josephine Gresham zusammen. „Auch die Politik ist gefordert, sinnvolle und für Landwirt:innen einhaltbare Rahmenbedingungen zu setzen, die Spielraum für die individuellen Gegebenheiten des betreffenden Betriebs lassen.“
Ein entscheidender Punkt bei allen Maßnahmen sind jedoch die Verbraucher:innen: Nur wenn sie das Fleisch kaufen und konsumieren, können sich die Aufzucht der Kälber und weitere Investitionen für die Landwirt:innen lohnen. Information und Aufklärungsarbeit sind nach Erkenntnissen der Forschenden ein wichtiger Schlüssel dazu.
Denn eine für Süddeutschland repräsentative Online-Umfrage unter 918 Teilnehmenden brachte überraschende Ergebnisse: Zwar wussten 63 Prozent der Befragten, dass Kuh und Kalb oft unmittelbar nach der Geburt voneinander getrennt und junge Kälber häufig über lange Strecken transportiert werden.
Jedoch sind Label, wie zum Beispiel „Zeit zu zweit – für Kuh + Kalb“, die für Produkte vergeben werden, bei denen die Kälber die ersten Lebensmonate bei der Mutter verbringen, weitgehend unbekannt. Auch andere Praktiken, das Problem des geringen Marktwertes der überschüssigen Bio-Milchviehkälber sowie die geringe Nachfrage nach Bio-Rindfleisch kannten nur sechs Prozent der Teilnehmenden.
„Vielen Menschen scheint der Zusammenhang zwischen Milch und Rind- bzw. Kalbfleisch nicht bewusst zu sein“, sagt Studienautorin Mareike Herrler vom Fachgebiet Angewandte Ernährungspsychologie der Universität Hohenheim. „Eventuell verdrängen sie diese Tatsache aber auch, um Schuldgefühle beim Kauf von Milchprodukten zu vermeiden.“
Tierwohl wichtig – Geschmack und Geld noch wichtiger
Denn die meisten Menschen sorgen sich um das Wohlergehen von Milchkälbern und empfinden Mitgefühl für diese Tiere. So ist das Tierwohl eines der wichtigsten Motive für den Kauf von Bio-Lebensmitteln: „Vor allem Personen, die sich der Probleme in der Tierhaltung bewusst sind, kaufen häufiger Bio-Milch und -Milchprodukte – möglicherweise in dem Glauben, damit einen Beitrag zum Tierwohl zu leisten“, so Mareike Herrler.
„Tatsächlich ist den Menschen der Geschmack der Produkte jedoch noch wichtiger und sie müssen sich die meist teureren Produkte auch leisten können“, fasst die Expertin ein anderes Ergebnis ihrer Studie zusammen. So konsumierten Befragte mit einem höheren Haushaltsnettoeinkommen sowohl Bio-Lebensmittel insgesamt als auch Bio-Milch und -Molkereiprodukte häufiger.
Gezielte Informationen über die Problematik und zu möglichen Lösungen fördert die Kaufbereitschaft für ethisch hergestellte Milch- und Fleischprodukte: „Die Menschen sind durchaus gewillt, ihren Teil zum Tierwohl beizutragen. Aber sie brauchen Anreize und die richtige Form der Informationen“, erklärt Prof. Dr. Nanette Ströbele-Benschop vom Fachgebiet Angewandte Ernährungspsychologie.
So erwartet die Kundschaft bei Kalbfleisch beispielsweise vor allem helles, zartes Fleisch. Doch qualitativ hochwertiges Fleisch von Kälbern, die nach geltenden Tierwohlstandards aufgezogen werden, ist deutlich rot gefärbt. „Hier muss darauf hingewiesen werden, dass rotes Kalbfleisch sogar ein Qualitätsmerkmal ist“, sagt Prof. Dr. Chagunda, „denn es enthält mehr ungesättigte Fettsäuren und besitzt eine wertvollere Proteinstruktur als helles Fleisch.“
Einen guten Ansatzpunkt die Nachfrage nach Bio-Kalbfleisch zu erhöhen sehen die Forschenden in der Betriebsgastronomie, wie beispielsweise in Kantinen, Mensen und Cafeterien. Hier bietet sich die Möglichkeit, bereits verarbeitete Gerichte aus Bio-Kalbfleisch zu probieren und sich gleichzeitig zu informieren. In einem Pilotversuch wurde das Angebot gut angenommen und die Kantinenleitung will auch in Zukunft Bio-Produkte bevorzugt anbieten. „Trotzdem ist es wichtig, dass das Fleisch auch im Supermarkt um die Ecke zu finden ist“, unterstreicht Mareike Herrler.
HINTERGRUND: Projekt WertKalb – Innovative Strategien für eine ethische Wertschöpfung der Kälber aus der ökologischen Milchviehhaltung
WertKalb ist eines von vier Projekten im Forschungsprogramm Ökologischer Landbau, das die Landesregierung von Baden-Württemberg ins Leben gerufen und finanziell gefördert hat. Koordiniert wird das Programm vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau an der Universität Hohenheim.
Ziel des Projektes war es, Antworten auf die drängende Frage zu liefern, wie eine tierethisch vertretbare, nachhaltige und den Prinzipien des ökologischen Landbaus konforme Entwicklung der Branche gestaltet werden kann. Somit trägt das Projekt zur Verringerung des Kälberproblems bei und unterstützt sowohl die Weiterentwicklung und Stärkung des ökologischen Landbaus als auch die landwirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation in Richtung Nachhaltigkeit und verstärktem Bio-Konsum.
Quelle: Universität Hohenheim