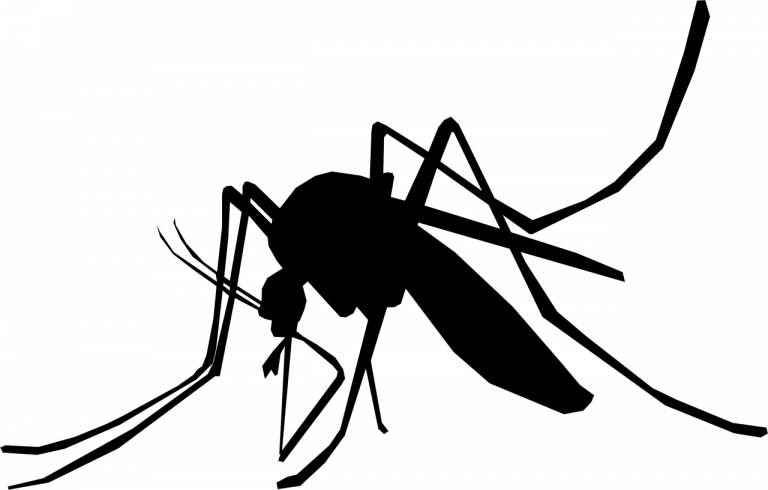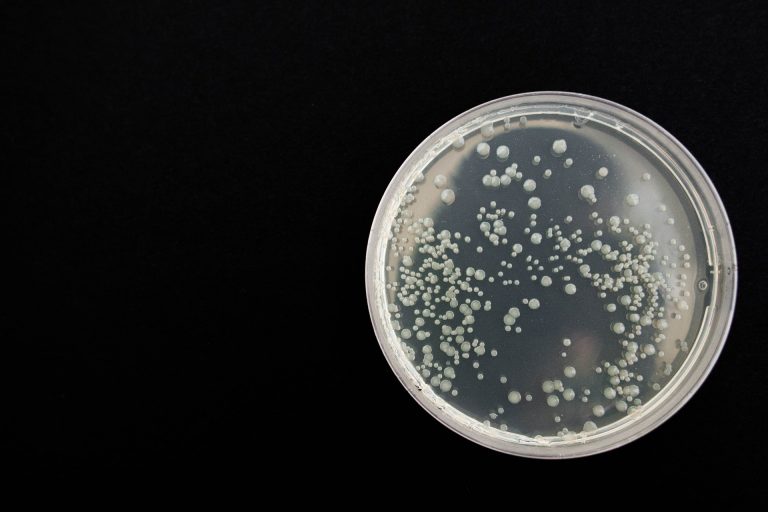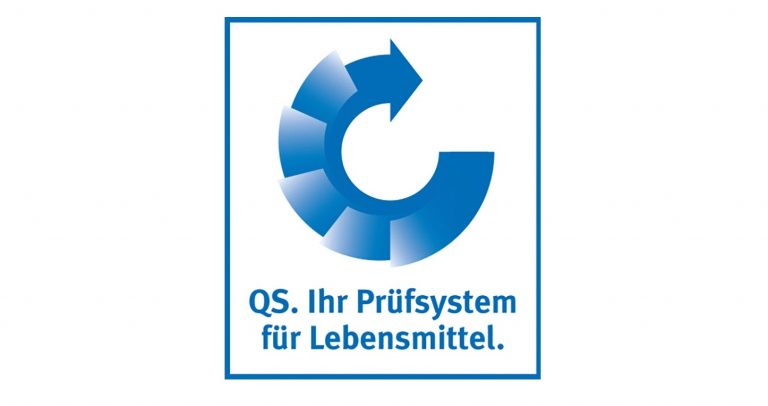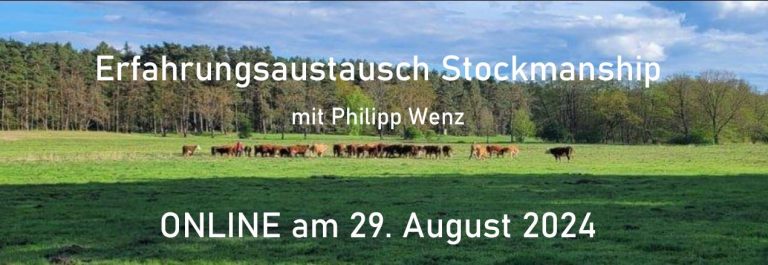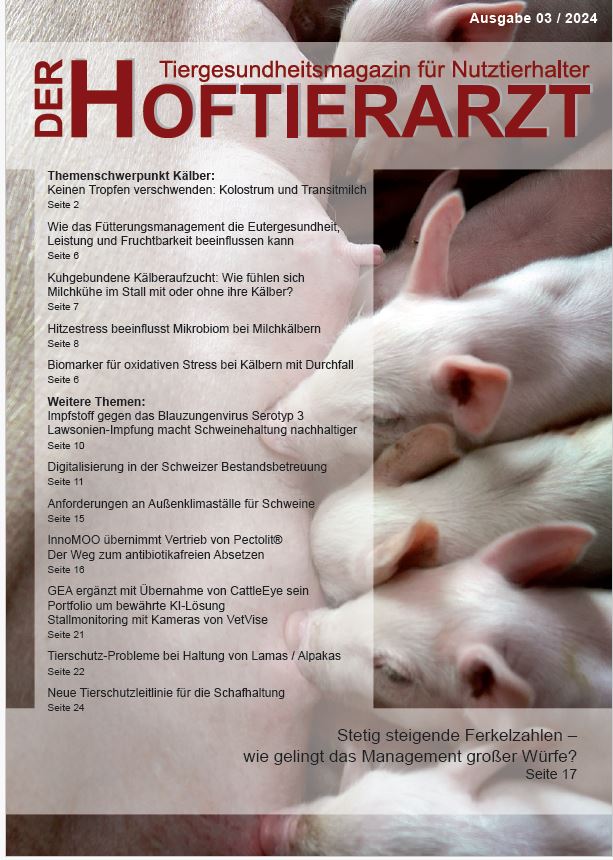Forschende des Complexity Science Hub (CSH) und der Vetmeduni entwickeln erstmals eine interaktive Landkarte zoonotischer Erreger in Österreich, die fast ein halbes Jahrhundert umspannt.
Die Schnittstellen zu identifizieren, an denen die Übertragung stattfindet – das ist eine der größten Schwierigkeiten bei der Bekämpfung von Zoonosen, also von Krankheiten, die zwischen Tier und Mensch übertragbar sind. „Unser Projekt begann mit der Frage: Können wir die zoonotischen Schnittstellen in Österreich charakterisieren und visualisieren?“, erklärt Amélie Desvars-Larrive vom Complexity Science Hub und der Vetmeduni Wien.
So entstand die erste umfassende Übersicht zur Übertragung von Zoonoseerregern zwischen Menschen, Tieren, Lebensmitteln, Überträgerarten wie Zecken und der Umwelt, mit aufschlussreichen Einblicken in Übertragungsketten. „Es handelt sich dabei um ein komplexes System, in dem die meisten Zoonoseerreger in der Lage sind, sowohl Menschen als auch verschiedene Tierarten aus unterschiedlichen Taxa zu infizieren“, so die Forscherin.
Die in Nature Communications veröffentlichte Studie zeigt zudem, dass die Anzahl der Zoonoseerreger in Österreich zunimmt – insbesondere in den letzten 20 Jahren, in denen acht neue Arten aufgetreten sind, darunter das West-Nil-Virus und das Usutu-Virus. „Auf ein erhöhtes Risiko der Übertragung von Zoonoseerregern deutet unsere Netzwerkanalyse an den Schnittstellen Mensch-Rind und Mensch-Lebensmittel hin“, erklärt Desvars-Larrive.
VON FLEISCH BIS ZECKEN
In ihrer Analyse stellten die Forscher:innen fest, dass bestimmte Quellen eine unverhältnismäßig große Rolle beim Austausch von Zoonoseerregern spielen ¬– wie Hühner, Rinder, Schafe und einige Fleischprodukte, die eine relativ große Zahl von Zoonoseerregern übertragen und potenziell verbreiten können.
Von 197 verschiedenen Zoonoseerregern, die im Zeitraum zwischen 1975 und 2022 dokumentiert wurden, konnten 187 in insgesamt 155 verschiedenen Wirbeltierwirten nachgewiesen werden. Elf Erreger kamen in umweltbezogenen Medien wie Sandkisten vor. Fünfzehn Erreger, vor allem Bakterien wie Listeria, Escherichia und Salmonella, wurden in Lebensmitteln gefunden – mehr als die Hälfte davon in Fleisch und Fleischerzeugnissen. Außerdem wurden 24 Krankheitserreger in Vektoren, also Überträgern, wie Zecken nachgewiesen. „Mit 16 verschiedenen übertragenen Erregern übertragen Zecken außerdem mehr Krankheiten als jeder andere Vektor“, erklärt Desvars-Larrive.
NEUE ERREGER
Zu den neu aufgetretenen Erregern in Österreich zählen das West-Nil-Virus, das 2016 erstmals in Österreich nachgewiesen wurde, und das Usutu-Virus, das seit 2001 in Österreich vorkommt und damals erstmals außerhalb von Afrika detektiert wurde. Beide Erreger kommen hauptsächlich in Vögeln vor, können aber durch Mückenstiche auf den Menschen übertragen werden und wurden beide auch bereits in Pferden nachgewiesen.
SECHS GEMEINSCHAFTEN
„Als wir uns angesehen haben, welche Wirbeltierwirte, Lebensmittel und Umweltquellen sich welche Pathogene teilen, stellten wir fest, dass das Netzwerk in Österreich in sechs Gemeinschaften organisiert ist“, so Desvars-Larrive, wobei der Mensch am meisten Erreger mit Haus- und Nutztieren wie Hunden, Katzen und Kühen teilt.
„Interessanterweise haben wir zum Beispiel auch festgestellt, dass Puten mehr Pathogene mit Lebensmitteln teilen als mit anderen Vogel- und Geflügelarten“, erklärt die Wissenschafterin weiter. Wildschweine, Hunde, Katzen und einige Nagetiere wiederum fungieren mitunter als „Brücken“ zwischen verschiedenen Gemeinschaften und können so dazu beitragen, dass sich Krankheiten leichter im Netz verbreiten.
BEWUSSTSEIN SCHAFFEN
Diese neue, netzwerkbasierte Methode bietet wertvolle Einblicke in zoonotische Übertragungsketten und kann so die Entwicklung von Strategien gegen Zoonosen erleichtern. „Zu wissen, welche Akteur:innen im Zoonosen-Netzwerk einflussreicher sind als andere, kann zum Beispiel in Überwachungsprogrammen für Zoonosen sehr hilfreich sein, da sie als Risikoindikatoren dienen könnten“, so Desvars-Larrive.
„Mit unserer interaktiven Karte wollen wir aufklären und Neugierde wecken“, sagt die Forscherin. „Natürlich kommen wir alle mit verschiedenen Krankheitserregern in Kontakt, wobei aber nur wenige tatsächlich zu einer Erkrankung führen und wir uns deshalb nicht zu große Sorgen machen sollten.“ Dennoch sei es gut, ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln – zum Beispiel dafür, wie wichtig es ist, ein Messer zwischen verschiedenen Lebensmitteln zu reinigen, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. „Oder wenn man von einer Zecke gebissen wurde, sollte man in den nächsten Wochen wachsam sein, denn Zecken übertragen eine ganze Reihe von Krankheiten auf Mensch und Tier, die oft schwer zu diagnostizieren sind, da die Symptome erst Wochen später auftreten können“, so Desvars-Larrive.
ÖSTERREICH IN ZAHLEN
In Österreich leben derzeit rund neun Millionen Menschen, Tendenz steigend. Österreichs Tierwelt umfasst rund 45.870 Arten, darunter 110 Säugetierarten. Darüber hinaus leben in 35 Prozent der 3,9 Millionen österreichischen Haushalte auch Haustiere. Das Land zählt etwa 53.300 Rinder, eine Million Schweine und fünf Millionen Stück Geflügel, während es rund 130.000 gültige Jagdscheine gibt. Diese Zahlen geben einen Eindruck darüber, wie viele Schnittstellen es allein zwischen Menschen und Tieren gibt.
DATENLAGE VERBESSERN
„Wir sehen in unseren Daten nur die Spitze des Eisbergs – nur jene Zoonosen, die tatsächlich diagnostiziert wurden. Leptospirose, beispielsweise, ist in Österreich noch relativ selten und kann grippeähnliche Symptome aufweisen. Wenn sie nicht eindeutig als Leptospirose diagnostiziert wurde, sehen wir das in den Daten nicht“, erklärt Desvars-Larrive.
Die koordinierte epidemiologische Überwachung konzentriert sich hauptsächlich auf meldepflichtige Krankheiten, wodurch amtlichen Zahlen häufig nicht regulierte Zoonoseerreger, die im Land zirkulieren, übersehen. „Eine solche Verzerrung kann zu einer verzerrten Bewertung des gesamten Zoonoserisikos führen“, so die Wissenschafterin.
Obwohl SARS-CoV-2 beispielsweise sowohl für Menschen als auch für Tiere meldepflichtig ist, wird es in keiner der COVID-19-bezogenen Publikationen, die sich mit menschlichen Fällen befassen, als Zoonose bezeichnet, weshalb es in diesen Daten nicht vorkommt. Auch die einzige Veröffentlichung, die SARS-CoV-2 bei österreichischen Tieren untersuchte, erwähnte das zoonotische Potenzial nicht.
Mehr und in zentralisierter Form vorliegende Daten über One Health – ein Ansatz, wonach die Gesundheit von Menschen, Tieren und Umwelt miteinander verknüpft ist – sind entscheidend für die Kontrolle und Prävention von zoonotischen Infektionskrankheiten. Es gibt zahlreiche Anstrengungen in dieser Richtung, vor allem seit der SARS-CoV-2-Pandemie, jedoch bestehen nach wie vor erhebliche Hürden, wie rechtliche Fragen im Bereich des Datenaustauschs. Insbesondere die Umweltaspekte von Zoonosen sind oft unterrepräsentiert, was es erschwert, ein vollständiges Bild zu erhalten. „Mit unserem Netzwerk haben wir jedoch einen ersten Überblick über die zoonotischen Schnittstellen von Menschen, Tieren, Lebensmitteln und der Umwelt geschaffen, was die Entwicklung von One-Health-Strategien gegen Zoonosen erleichtern kann“, so Desvars-Larrive.
INTERAKTIVE ZOONOSEKARTE
Die Forschenden führten zunächst eine systematische Literaturrecherche zu allen dokumentierten Zoonoseerregern in Österreich zwischen 1975 und 2022 durch. „Daraus erstellten wir ein Netzwerk, das die Beziehungen zwischen Zoonoseerregern, ihren Wirten, Überträgern wie Zecken oder Moskitos, aber auch andere – oft vernachlässigte – Infektionsquellen, wie eine kontaminierte Umwelt, zum Beispiel eine Sandkiste, oder kontaminierte Lebensmittelquellen in Österreich beschreibt“, so Desvars-Larrive. Die Ergebnisse der Analyse wurden von CSH-Datenvisualisierungsexpertin Liuhuaying Yang in einer interaktiven Zoonose-Landkarte Österreichs aufbereitet, die öffentlich zugänglich ist.
Zoonosekarte online
Quelle: Veterinärmedizinische Universität Wien