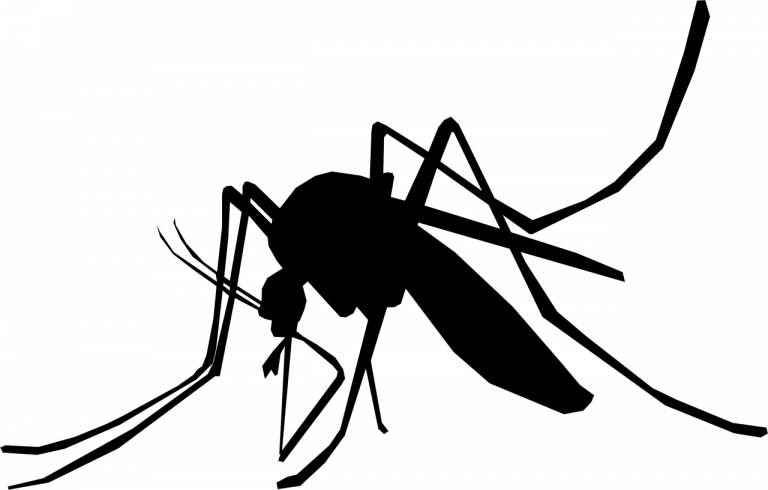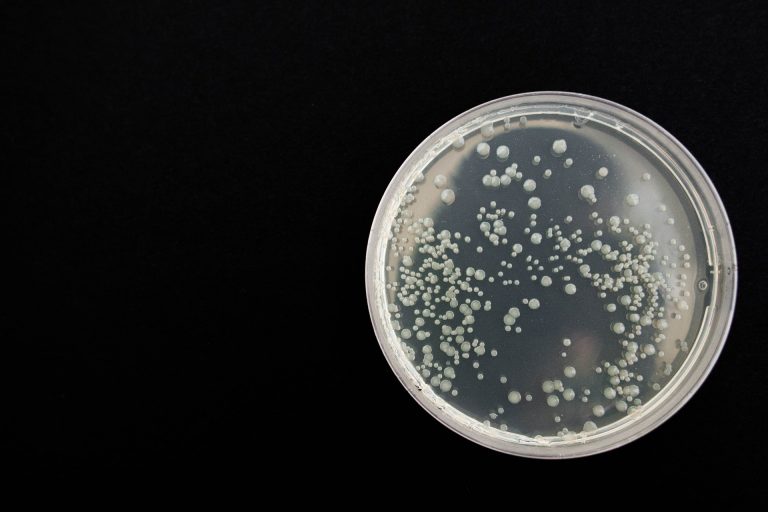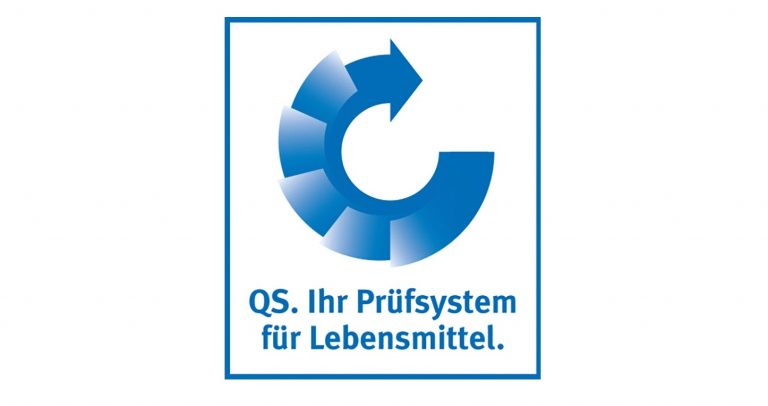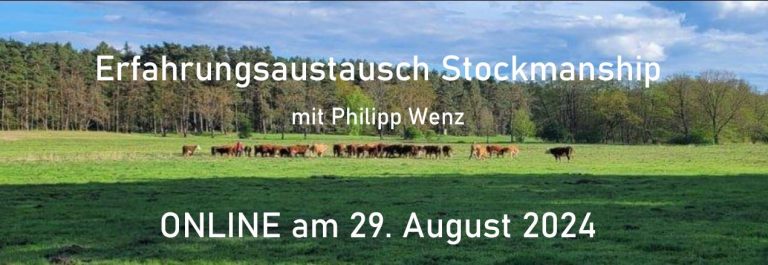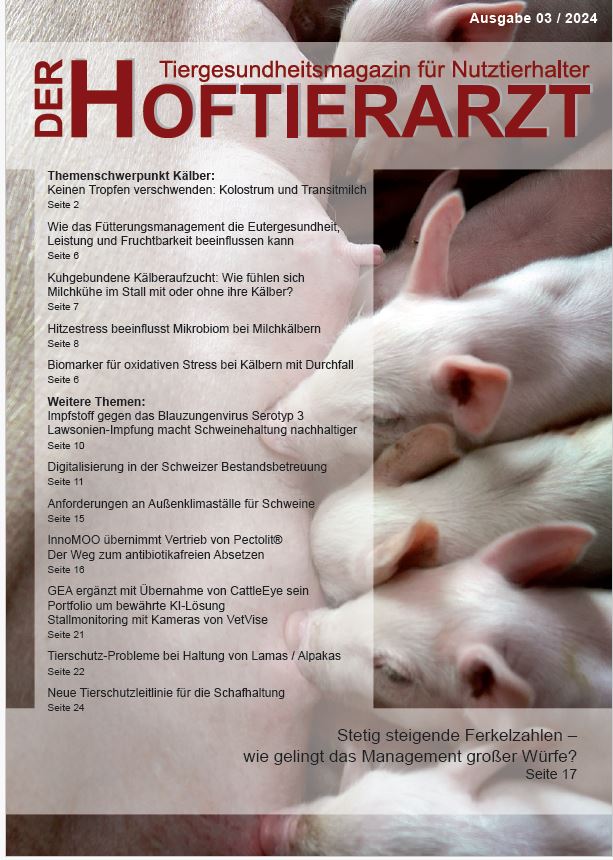Neueste Beiträge
Infektionsrisiko mit dem West-Nil-Virus in Deutschland
Forschende der Biogeografie der Universität Bayreuth haben das erste Modell entwickelt, das das räumliche und zeitliche Risiko einer Infektion mit dem West-Nil-Virus in Standvögeln, Zugvögeln und dem Menschen in Deutschland simuliert. Damit legen sie die Basis für ein Warnsystem für Krankheiten, deren Übertragung durch den Klimawandel beeinflusst wird.
Das von Stechmücken auf den Menschen übertragbare West-Nil-Virus (WNV) tritt seit langem im Südeuropa auf. Begünstigt durch den Klimawandel ist eine Übertragung auch in nördlicheren Gebieten möglich. In Deutschland wurden Krankheitsfälle beim Menschen erstmals 2019 registriert. Ein Modell, welches das Infektionsrisiko in Deutschland abbildet, kann als Warnsystem fungieren und dabei helfen, geeignete Präventionsmaßnahmen zu treffen und die ärztliche Differentialdiagnostik anzupassen.
Das WNV gehört zu den Flaviviren und wird von Stechmücken zwischen wildlebenden Vögeln übertragen. An Vögeln infizierte Mücken können das Virus auch auf Menschen übertragen. In Südeuropa kommt es schon seit langem im Sommer zu Ausbrüchen. Bisher waren die Sommertemperaturen in Deutschland durchgehend am Tag und in der Nacht nicht warm genug für eine Übertragung durch die weitverbreitete Gemeine Stechmücke. Seit 2019 sind allerdings auch in Deutschland Fälle von Infektionen beim Menschen bekannt sind. Das West-Nil-Fieber heilt meist ohne Komplikationen aus. Jedoch sind Spätfolgen bei Erkrankten, die Entzündungen des Gehirns entwickelten, häufig und Personen mit Vorerkrankung oder ältere Menschen können aufgrund des in das Nervengewebe eindringenden West-Nil-Virus sterben.
Oliver Chinonso Mbaoma, Dr. Stephanie Thomas und Prof. Dr. Carl Beierkuhnlein vom Lehrstuhl für Biogeografie der Universität Bayreuth haben ein Modell entwickelt, mit dem das räumliche und zeitliche Infektionsrisiko mit dem WNV in Deutschland simuliert werden kann. Das Modell basiert auf Umweltdaten wie tägliche Temperatur und Niederschlag sowie epidemiologischen Daten und wurde anhand der menschlichen und tierischen WNV-Fälle der letzten fünf Jahre überprüft. Zudem bezog das Forschungsteam Eigenschaften der Moskitos und Vogelarten, die für die Übertragung des WNV besonders wichtig sind, in die Berechnungen mit ein.
Die Modellergebnisse bilden bisherige Gebiete mit WNV-Fällen gut ab und zeigen weitere Gebiete im Westen von Nordrhein-Westfalen, Ober- und Mittelrhein sowie einzelne Landkreise in Bayern auf, in denen eine Übertragung aus klimatischer Sicht von Juli bis Ende Oktober möglich wäre.
„Unsere Ergebnisse legen den Grundstein für ein Frühwarnsystem für Infektionskrankheiten, deren Übertragung durch die steigenden Temperaturen begünstigt wird. Das Modell kann dem öffentlichen Gesundheitsdienst dabei helfen, Präventionsmaßnahmen zu treffen. Zudem kann die Ärzteschaft anhand der Risikolage die Differentialdiagnostik anpassen“, sagt Thomas.
Die Forschungsarbeit wurde durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege über das Projekt BayByeMos (AP-2411-PN 21-14-V3-D22827/2022) im Rahmen des Verbundprojekts „Klimawandel und Gesundheit II“ (VKG II) gefördert.
Quelle: Universität Bayreuth
Süddeutsche Schweinefleischerzeugung – zukunftsorientiert, klimafreundlich, wirtschaftlich
Im Rahmen der Projekte „SüdSchwein4Klima“ und „Netzwerk Fokus Tierwohl“ fand am 04. Juli in Ulm-Seligweiler eine gemeinsame Informationsveranstaltung statt, welche die Nachhaltigkeit der süddeutschen Schweinehaltung in den Mittelpunkt stellte, um diese zielgerichtet zu gestalten. Zu der hybriden Veranstaltung waren rund 60 Teilnehmende entlang der Wertschöpfungskette Schweinefleisch nach Ulm-Seligweiler gekommen. Etwa 40 weitere Teilnehmende verfolgten die Veranstaltung online. Vertreten waren Verbände, schweinehaltende Betriebe, Züchter*innen, der Viehhandel, Schlachtbetriebe, Hersteller*innen von Wurst- und Fleischwaren sowie Vertreter*innen aus Verwaltung und Politik.
Zum Auftakt der Veranstaltung wurden die beiden Projekte vorgestellt. Das vom BMEL geförderte deutschlandweite Verbundprojekt „Netzwerk Fokus Tierwohl“ verfolgt das Ziel bereits vorhandenes Fachwissen aus Wissenschaft, Forschung und Praxis zum Thema Tierwohl, Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu bündeln, aufzubereiten und in die Praxis weiterzugeben. Der Wissenstransfer wird von den Projektpartnern in verschiedenen Formaten umgesetzt.
Im Rahmen des EIP-AGRI Projektes „SüdSchwein4Klima“ hat sich eine operationelle Gruppe (OPG) gebildet, bestehend aus Partnern der land- und forstwirtschaftlichen Praxis, Forschungs- und Versuchseinrichtungen, Verarbeitungs- und Vermarktungsunternehmen sowie Verbänden und landwirtschaftlichen Organisationen in Bayern und Baden-Württemberg. Gemeinsam erarbeiten sie ein zentrales Nachhaltigkeitsmodul in der Informationsplattform Qualifood®, welches eine Nachhaltigkeitsbibliothek sowie einen Klima-Schnellcheck beinhaltet. Nutzer*innen insbesondere Landwirt*innen sollen somit eine einfache und sichere Möglichkeit haben, an Informationen rund um das Thema Nachhaltigkeit zu gelangen. Der Klima-Schnellcheck ermöglicht eine erste Einschätzung hinsichtlich der Klimafreundlichkeit landwirtschaftlicher Betriebe.
Qualifood® wird bereits jetzt von den meisten schweinehaltenden Betrieben in Süddeutschland genutzt. Die Integration eines solchen Moduls unterstützt daher die süddeutsche Schweinefleischerzeugung, sich klimafreundlich, tierwohlorientiert und wirtschaftlich zukunftsfähig auszurichten.
Einige Forschungsvorhaben und Maßnahmen für die Entwicklung einer nachhaltigen Tierhaltung im süddeutschen Raum und darüber hinaus existieren bereits. Das wurde durch die Fachvorträge zu verschiedenen Projekten deutlich. Hierzu referierten Professor*innen der Universitäten Hohenheim und Göttingen sowie Mitarbeiter*innen der LfL Bayern, der LSZ Boxberg, der Bodensee-Stiftung, des Fleischprüfrings Bayern e.V. sowie der Ringgemeinschaft Bayern e.V..
Alle Beiträge standen im Kontext einer nachhaltigen, kreislauforientierten Tierhaltung und zeigten die Komplexität der Nachhaltigkeitsthemen, die Zusammenhänge sowie die Herausforderungen und Möglichkeiten , die sich hieraus ergeben.
Angefangen bei der „Gestaltung einer tiergerechten Haltung“ nahm das Programm die zentralen Nachhaltigkeitsaspekte „Futtermittel und Fütterung“, „Wirtschaftsdüngermanagement“ sowie „Kommunikation innerhalb der Wertschöpfungskette“ in den Blick. Diese Aspekte sind wichtige Stellschrauben bei der Gestaltung einer nachhaltigen Schweinehaltung.
Die Vorstellung von zwei Erfassungsmethoden zur Klimawirkung, dem LfL Klima-Check sowie dem ACCT-Tool, welches von der Bodensee-Stiftung mitentwickelt wurde, rundeten das Programm ab. Neben informativem Input, bot die Veranstaltung ebenfalls die Möglichkeit zur Diskussion zu den vorgestellten Inhalten.
Nähere Informationen zu dem Projekt „Netzwerk Fokus Tierwohl“ finden Sie unter der QR-Code rechts. Nähere Informationen zu dem Projekt „SüdSchwein4Klima“ finden Sie unter dem QR-Code links.
Nähere Informationen zu dem Projekt „SüdSchwein4Klima“ finden Sie unter dem QR-Code links. Das Projekt wird gefördert im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ (EIP-AGRI). Die Projektförderung ist eine Maßnahme des Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014-2020 (MEPL III). Es wird durch das Land Baden-Württemberg und über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) finanziert.
OPG-Mitglieder:
▪ Schweinezuchtverband Baden-Württemberg e.V. (Leadpartner)
▪ Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg (LSZ Boxberg)
▪ Fleischprüfring Bayern e.V.
▪ Universität Hohenheim mit der Landesanstalt für Agrartechnik und Bioenergie
▪ Bodensee-Stiftung
▪ Müller Fleisch GmbH
▪ Süddeutsches Schweinefleischzentrum Ulm Donautal GmbH
▪ Ulmer Fleisch GmbH
▪ Bayerischer Bauernverband KdÖR
▪ Landesbauernverband in Baden-Württemberg e.V.
▪ Bioland Erzeugerring Bayern e.V.
▪ Raiffeisen Viehzentrale GmbH
▪ Erzeugergemeinschaft Südbayern e.G.
▪ Ringgemeinschaft Bayern e.V.
▪ Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben w.V.
▪ UEG Hohenlohe-Franken w.V.
▪ Bayerische Bauern Marketing GmbH
▪ 5 landwirtschaftliche Betriebe
Quelle: Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg – Schweinehaltung und Schweinezucht – (Landesanstalt für Schweinezucht – LSZ)
Das Projekt wird gefördert im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ (EIP-AGRI). Die Projektförderung ist eine Maßnahme des Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014-2020 (MEPL III). Es wird durch das Land Baden-Württemberg und über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) finanziert.
OPG-Mitglieder:
▪ Schweinezuchtverband Baden-Württemberg e.V. (Leadpartner)
▪ Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg (LSZ Boxberg)
▪ Fleischprüfring Bayern e.V.
▪ Universität Hohenheim mit der Landesanstalt für Agrartechnik und Bioenergie
▪ Bodensee-Stiftung
▪ Müller Fleisch GmbH
▪ Süddeutsches Schweinefleischzentrum Ulm Donautal GmbH
▪ Ulmer Fleisch GmbH
▪ Bayerischer Bauernverband KdÖR
▪ Landesbauernverband in Baden-Württemberg e.V.
▪ Bioland Erzeugerring Bayern e.V.
▪ Raiffeisen Viehzentrale GmbH
▪ Erzeugergemeinschaft Südbayern e.G.
▪ Ringgemeinschaft Bayern e.V.
▪ Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben w.V.
▪ UEG Hohenlohe-Franken w.V.
▪ Bayerische Bauern Marketing GmbH
▪ 5 landwirtschaftliche Betriebe
Quelle: Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg – Schweinehaltung und Schweinezucht – (Landesanstalt für Schweinezucht – LSZ)
 Nähere Informationen zu dem Projekt „SüdSchwein4Klima“ finden Sie unter dem QR-Code links.
Nähere Informationen zu dem Projekt „SüdSchwein4Klima“ finden Sie unter dem QR-Code links. Das Projekt wird gefördert im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ (EIP-AGRI). Die Projektförderung ist eine Maßnahme des Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014-2020 (MEPL III). Es wird durch das Land Baden-Württemberg und über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) finanziert.
OPG-Mitglieder:
▪ Schweinezuchtverband Baden-Württemberg e.V. (Leadpartner)
▪ Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg (LSZ Boxberg)
▪ Fleischprüfring Bayern e.V.
▪ Universität Hohenheim mit der Landesanstalt für Agrartechnik und Bioenergie
▪ Bodensee-Stiftung
▪ Müller Fleisch GmbH
▪ Süddeutsches Schweinefleischzentrum Ulm Donautal GmbH
▪ Ulmer Fleisch GmbH
▪ Bayerischer Bauernverband KdÖR
▪ Landesbauernverband in Baden-Württemberg e.V.
▪ Bioland Erzeugerring Bayern e.V.
▪ Raiffeisen Viehzentrale GmbH
▪ Erzeugergemeinschaft Südbayern e.G.
▪ Ringgemeinschaft Bayern e.V.
▪ Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben w.V.
▪ UEG Hohenlohe-Franken w.V.
▪ Bayerische Bauern Marketing GmbH
▪ 5 landwirtschaftliche Betriebe
Quelle: Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg – Schweinehaltung und Schweinezucht – (Landesanstalt für Schweinezucht – LSZ)
Das Projekt wird gefördert im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ (EIP-AGRI). Die Projektförderung ist eine Maßnahme des Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014-2020 (MEPL III). Es wird durch das Land Baden-Württemberg und über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) finanziert.
OPG-Mitglieder:
▪ Schweinezuchtverband Baden-Württemberg e.V. (Leadpartner)
▪ Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg (LSZ Boxberg)
▪ Fleischprüfring Bayern e.V.
▪ Universität Hohenheim mit der Landesanstalt für Agrartechnik und Bioenergie
▪ Bodensee-Stiftung
▪ Müller Fleisch GmbH
▪ Süddeutsches Schweinefleischzentrum Ulm Donautal GmbH
▪ Ulmer Fleisch GmbH
▪ Bayerischer Bauernverband KdÖR
▪ Landesbauernverband in Baden-Württemberg e.V.
▪ Bioland Erzeugerring Bayern e.V.
▪ Raiffeisen Viehzentrale GmbH
▪ Erzeugergemeinschaft Südbayern e.G.
▪ Ringgemeinschaft Bayern e.V.
▪ Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben w.V.
▪ UEG Hohenlohe-Franken w.V.
▪ Bayerische Bauern Marketing GmbH
▪ 5 landwirtschaftliche Betriebe
Quelle: Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg – Schweinehaltung und Schweinezucht – (Landesanstalt für Schweinezucht – LSZ) Information zur Blauzungenkrankheit: Rasch ansteigende Infektionszahlen – Impfung empfohlen
In den vergangenen Wochen steigt die Zahl der Infektionen mit der Blauzungenkrankheit stark an. Besonders betroffen sind die Niederlande und in Deutschland das Land Nordrhein-Westfalen. In den Niederlanden wurden seit Mitte Juni 2024 über 500 Fälle der Blauzungenkrankheit des Serotyps 3 (BTV-3) nachgewiesen. Innerhalb der letzten vier Wochen erfolgten über 400 Nachweise von BTV-3 in nordrhein-westfälischen Betrieben. Auch für Niedersachsen ist ein Anstieg der BTV-3-Fälle festzustellen. Während in Niedersachsen im Jahr 2024 90 BTV-3-Infektionen nachgewiesen wurden (Stand: 22. Juli 2024), erfolgten etwa 50 Prozent der Feststellungen innerhalb der letzten vier Wochen.
Aus den Niederlanden wird berichtet, dass auch Tierbestände von BTV-3-Nachweisen betroffen sind, die gegen das Virus geimpft wurden. Es sei daraus aktuell jedoch nicht zu schlussfolgern, dass die Impfung nicht wirksam sei. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) und die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin empfehlen weiterhin empfängliche Tiere mit einem zur Anwendung gestatteten Impfstoff gegen BTV-3 zu impfen. Derzeit stehen in Deutschland drei Impfstoffe zur Verfügung, deren Anwendung per Verordnung gestattet wurde. Es gibt keine Möglichkeit die Blauzungenkrankheit therapeutisch zu bekämpfen. Neben einer Impfung können jedoch bestimmte mückenabweisende Mittel (Repellents) abwehrende Wirkung hervorrufen. Die Anwendung von Repellents ist bei bestimmten Verbringungen sogar rechtlich vorgeschrieben (siehe Hintergrund).
Im Rahmen einer Härtebeihilfe übernimmt die Niedersächsische Tierseuchenkasse weiterhin die Kosten für eine Impfstoffdosis pro Schaf bzw. Ziege, maximal jedoch 3 Euro. Voraussetzung ist, dass die Impfung in der HI-Tier-Datenbank eingetragen wird und der Antrag auf Beihilfe, sobald technisch möglich, digital über die Homepage der Tierseuchenkasse gestellt wird. Bis dahin ist der Antrag per Papier über das zuständige Veterinäramt bei der Niedersächsischen Tierseuchenkasse einzureichen. Die Möglichkeit Härtebeihilfe zu beantragen, werde nach Mitteilung der Niedersächsischen Tierseuchenkasse von niedersächsischen Schaf- und Ziegenhaltern gut in Anspruch genommen.
Hintergrund:
Die aktuelle BTV-3-Inzidenzentwicklung belegt, dass die laut einer qualitativen Risikobewertung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) als besonders hoch eingeschätzte Gefahr der Virusübertragung auf empfängliche Tiere zwischen Mai und Oktober zutrifft. Für das Virus empfänglich sind insbesondere Schafe und Ziegen, aber auch Rinder sowie Neuweltkameliden wie Alpakas und Wildwiederkäuer können sich mit dem Virus infizieren. BTV-3 Infektionen beim Schaf und bei der Ziege können mit erheblichen Tierverlusten und mit Tierleid einhergehen.
Bei Rindern und anderen Wiederkäuern verläuft die Erkrankung in der Regel mit milder Symptomatik. Die Krankheit wird von Gnitzen, blutsaugenden Mücken der Gattung Culicoides übertragen. Auf diesem Wege kann eine Verbreitung auch nach dem Verbringen infizierter Tiere stattfinden. Daher gelten für die Bestände in Niedersachsen, sowie in anderen von BTV-3 betroffenen Ländern, strengere Regeln wie eine verpflichtende PCR-Testung oder eine Behandlung mit mückenabweisenden Mitteln bei einer Verbringung in BTV-freie Gebiete. Seit dem ersten Ausbruchsfall am 25. Oktober 2023 im Landkreis Ammerland wurden insgesamt 111 Feststellungen bei Schafen und Rindern aus 25 Landkreisen und kreisfreien Städten in Niedersachsen gemeldet (Stand 22. Juli 2024).
Auf Menschen ist die Krankheit nicht übertragbar – auch nicht durch den Konsum von tierischen Produkten.
Links:
Webseite Tierseuchen-Info des LAVES
Risikobewertung des FLI
Steckbrief Blauzungenkrankheit des FLI
TSIS – TierSeuchenInformationssystem des FLI
Ständige Impfkommission Veterinärmedizin: Stellungnahme zur Impfung empfänglicher Wiederkäuer gegen BTV-3
Quelle: Herausgeber: Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Acht neue Zoonoseerreger in Österreich in den letzten 20 Jahren
Forschende des Complexity Science Hub (CSH) und der Vetmeduni entwickeln erstmals eine interaktive Landkarte zoonotischer Erreger in Österreich, die fast ein halbes Jahrhundert umspannt.
Die Schnittstellen zu identifizieren, an denen die Übertragung stattfindet – das ist eine der größten Schwierigkeiten bei der Bekämpfung von Zoonosen, also von Krankheiten, die zwischen Tier und Mensch übertragbar sind. „Unser Projekt begann mit der Frage: Können wir die zoonotischen Schnittstellen in Österreich charakterisieren und visualisieren?“, erklärt Amélie Desvars-Larrive vom Complexity Science Hub und der Vetmeduni Wien.
So entstand die erste umfassende Übersicht zur Übertragung von Zoonoseerregern zwischen Menschen, Tieren, Lebensmitteln, Überträgerarten wie Zecken und der Umwelt, mit aufschlussreichen Einblicken in Übertragungsketten. „Es handelt sich dabei um ein komplexes System, in dem die meisten Zoonoseerreger in der Lage sind, sowohl Menschen als auch verschiedene Tierarten aus unterschiedlichen Taxa zu infizieren“, so die Forscherin.
Die in Nature Communications veröffentlichte Studie zeigt zudem, dass die Anzahl der Zoonoseerreger in Österreich zunimmt – insbesondere in den letzten 20 Jahren, in denen acht neue Arten aufgetreten sind, darunter das West-Nil-Virus und das Usutu-Virus. „Auf ein erhöhtes Risiko der Übertragung von Zoonoseerregern deutet unsere Netzwerkanalyse an den Schnittstellen Mensch-Rind und Mensch-Lebensmittel hin“, erklärt Desvars-Larrive.
VON FLEISCH BIS ZECKEN
In ihrer Analyse stellten die Forscher:innen fest, dass bestimmte Quellen eine unverhältnismäßig große Rolle beim Austausch von Zoonoseerregern spielen ¬– wie Hühner, Rinder, Schafe und einige Fleischprodukte, die eine relativ große Zahl von Zoonoseerregern übertragen und potenziell verbreiten können.
Von 197 verschiedenen Zoonoseerregern, die im Zeitraum zwischen 1975 und 2022 dokumentiert wurden, konnten 187 in insgesamt 155 verschiedenen Wirbeltierwirten nachgewiesen werden. Elf Erreger kamen in umweltbezogenen Medien wie Sandkisten vor. Fünfzehn Erreger, vor allem Bakterien wie Listeria, Escherichia und Salmonella, wurden in Lebensmitteln gefunden – mehr als die Hälfte davon in Fleisch und Fleischerzeugnissen. Außerdem wurden 24 Krankheitserreger in Vektoren, also Überträgern, wie Zecken nachgewiesen. „Mit 16 verschiedenen übertragenen Erregern übertragen Zecken außerdem mehr Krankheiten als jeder andere Vektor“, erklärt Desvars-Larrive.
NEUE ERREGER
Zu den neu aufgetretenen Erregern in Österreich zählen das West-Nil-Virus, das 2016 erstmals in Österreich nachgewiesen wurde, und das Usutu-Virus, das seit 2001 in Österreich vorkommt und damals erstmals außerhalb von Afrika detektiert wurde. Beide Erreger kommen hauptsächlich in Vögeln vor, können aber durch Mückenstiche auf den Menschen übertragen werden und wurden beide auch bereits in Pferden nachgewiesen.
SECHS GEMEINSCHAFTEN
„Als wir uns angesehen haben, welche Wirbeltierwirte, Lebensmittel und Umweltquellen sich welche Pathogene teilen, stellten wir fest, dass das Netzwerk in Österreich in sechs Gemeinschaften organisiert ist“, so Desvars-Larrive, wobei der Mensch am meisten Erreger mit Haus- und Nutztieren wie Hunden, Katzen und Kühen teilt.
„Interessanterweise haben wir zum Beispiel auch festgestellt, dass Puten mehr Pathogene mit Lebensmitteln teilen als mit anderen Vogel- und Geflügelarten“, erklärt die Wissenschafterin weiter. Wildschweine, Hunde, Katzen und einige Nagetiere wiederum fungieren mitunter als „Brücken“ zwischen verschiedenen Gemeinschaften und können so dazu beitragen, dass sich Krankheiten leichter im Netz verbreiten.
BEWUSSTSEIN SCHAFFEN
Diese neue, netzwerkbasierte Methode bietet wertvolle Einblicke in zoonotische Übertragungsketten und kann so die Entwicklung von Strategien gegen Zoonosen erleichtern. „Zu wissen, welche Akteur:innen im Zoonosen-Netzwerk einflussreicher sind als andere, kann zum Beispiel in Überwachungsprogrammen für Zoonosen sehr hilfreich sein, da sie als Risikoindikatoren dienen könnten“, so Desvars-Larrive.
„Mit unserer interaktiven Karte wollen wir aufklären und Neugierde wecken“, sagt die Forscherin. „Natürlich kommen wir alle mit verschiedenen Krankheitserregern in Kontakt, wobei aber nur wenige tatsächlich zu einer Erkrankung führen und wir uns deshalb nicht zu große Sorgen machen sollten.“ Dennoch sei es gut, ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln – zum Beispiel dafür, wie wichtig es ist, ein Messer zwischen verschiedenen Lebensmitteln zu reinigen, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. „Oder wenn man von einer Zecke gebissen wurde, sollte man in den nächsten Wochen wachsam sein, denn Zecken übertragen eine ganze Reihe von Krankheiten auf Mensch und Tier, die oft schwer zu diagnostizieren sind, da die Symptome erst Wochen später auftreten können“, so Desvars-Larrive.
ÖSTERREICH IN ZAHLEN
In Österreich leben derzeit rund neun Millionen Menschen, Tendenz steigend. Österreichs Tierwelt umfasst rund 45.870 Arten, darunter 110 Säugetierarten. Darüber hinaus leben in 35 Prozent der 3,9 Millionen österreichischen Haushalte auch Haustiere. Das Land zählt etwa 53.300 Rinder, eine Million Schweine und fünf Millionen Stück Geflügel, während es rund 130.000 gültige Jagdscheine gibt. Diese Zahlen geben einen Eindruck darüber, wie viele Schnittstellen es allein zwischen Menschen und Tieren gibt.
DATENLAGE VERBESSERN
„Wir sehen in unseren Daten nur die Spitze des Eisbergs – nur jene Zoonosen, die tatsächlich diagnostiziert wurden. Leptospirose, beispielsweise, ist in Österreich noch relativ selten und kann grippeähnliche Symptome aufweisen. Wenn sie nicht eindeutig als Leptospirose diagnostiziert wurde, sehen wir das in den Daten nicht“, erklärt Desvars-Larrive.
Die koordinierte epidemiologische Überwachung konzentriert sich hauptsächlich auf meldepflichtige Krankheiten, wodurch amtlichen Zahlen häufig nicht regulierte Zoonoseerreger, die im Land zirkulieren, übersehen. „Eine solche Verzerrung kann zu einer verzerrten Bewertung des gesamten Zoonoserisikos führen“, so die Wissenschafterin.
Obwohl SARS-CoV-2 beispielsweise sowohl für Menschen als auch für Tiere meldepflichtig ist, wird es in keiner der COVID-19-bezogenen Publikationen, die sich mit menschlichen Fällen befassen, als Zoonose bezeichnet, weshalb es in diesen Daten nicht vorkommt. Auch die einzige Veröffentlichung, die SARS-CoV-2 bei österreichischen Tieren untersuchte, erwähnte das zoonotische Potenzial nicht.
Mehr und in zentralisierter Form vorliegende Daten über One Health – ein Ansatz, wonach die Gesundheit von Menschen, Tieren und Umwelt miteinander verknüpft ist – sind entscheidend für die Kontrolle und Prävention von zoonotischen Infektionskrankheiten. Es gibt zahlreiche Anstrengungen in dieser Richtung, vor allem seit der SARS-CoV-2-Pandemie, jedoch bestehen nach wie vor erhebliche Hürden, wie rechtliche Fragen im Bereich des Datenaustauschs. Insbesondere die Umweltaspekte von Zoonosen sind oft unterrepräsentiert, was es erschwert, ein vollständiges Bild zu erhalten. „Mit unserem Netzwerk haben wir jedoch einen ersten Überblick über die zoonotischen Schnittstellen von Menschen, Tieren, Lebensmitteln und der Umwelt geschaffen, was die Entwicklung von One-Health-Strategien gegen Zoonosen erleichtern kann“, so Desvars-Larrive.
INTERAKTIVE ZOONOSEKARTE
Die Forschenden führten zunächst eine systematische Literaturrecherche zu allen dokumentierten Zoonoseerregern in Österreich zwischen 1975 und 2022 durch. „Daraus erstellten wir ein Netzwerk, das die Beziehungen zwischen Zoonoseerregern, ihren Wirten, Überträgern wie Zecken oder Moskitos, aber auch andere – oft vernachlässigte – Infektionsquellen, wie eine kontaminierte Umwelt, zum Beispiel eine Sandkiste, oder kontaminierte Lebensmittelquellen in Österreich beschreibt“, so Desvars-Larrive. Die Ergebnisse der Analyse wurden von CSH-Datenvisualisierungsexpertin Liuhuaying Yang in einer interaktiven Zoonose-Landkarte Österreichs aufbereitet, die öffentlich zugänglich ist.
Zoonosekarte online
Quelle: Veterinärmedizinische Universität Wien
Forschung zu nachhaltiger Rindernutzung und kuhgebundener Kälberaufzucht
Ein Forschungsprojekt der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) zeigt, wie nachhaltige Milch- und Rindfleischerzeugung durch geschlossene Bio-Wertschöpfungsketten und kuhgebundene Kälberaufzucht funktionieren kann.
Bei der Abschlussveranstaltung des Projekts mehrWERT Öko-Milch + Fleisch unter Leitung von Prof. Dr. Dr. Eva Zeiler wurden Ende Mai an der Fakultät für Nachhaltige Agrar- und Energiesysteme der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) die wichtigsten Ergebnisse aus dem dreieinhalbjährigen Projekt vorgestellt. Umfassende Informationen finden sich im Abschlussbericht. Unter den 62 Teilnehmenden waren Landwirtinnen und Landwirte, milch- und fleischverarbeitende Betriebe sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Beratung und Wissenschaft.
Bei Kälbern aus bayerischen Öko-Milchviehbetrieben verbleibt bislang nur ein sehr geringer Anteil in der Biowertschöpfungskette, der letztendlich als Öko-Rindfleisch vermarktet wird. Die Forschenden ermittelten belastbare Zahlen und identifizierten alternative Wege zur Vermarktung bzw. Verwertung von Kälbern. Damit kann das grundsätzlich positive Image der Verbraucher:innen bezüglich der Biolandwirtschaft dauerhaft gesichert und einer mittelfristig aufkommenden Debatte zur Thematik proaktiv begegnet werden.
Am Vormittag präsentierten die Projektbeteiligten von HSWT, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) die Ergebnisse ihrer jeweiligen Arbeitspakete.
Peter Weindl (HSWT) stellte Ergebnisse aus studentischen Abschlussarbeiten zum Thema „Kälber der ökologischen Milchviehhaltung in Bayern“ vor, im Einzelnen
• Status quo-Erhebungen zu Kälbern auf Öko-Milchviehbetrieben,
• Erhebungen zur Öko-Rindermast in Bayern,
• Erfolgsfaktoren von Vermarktungsinitiativen und
• Öko-Rindfleisch in der Außer-Haus-Verpflegung (Fokus Nordbayern).
Theresa Hautzinger, (HSWT) ergänzte die Ergebnisse zur praktischen Umsetzung der kuhgebundenen Kälberaufzucht bis hin zur Gewichtsentwicklung und Gesundheit der Kälber.
Bernhard Ippenberger (LfL) rückte bei seinem Vortrag „Nachhaltige Rinderhaltung – das ist mehr als Tierwohl und Klimaschutz“ die ökonomische Betrachtung in den Fokus. Saro Ratter (Schweisfurth Stiftung) zeigte die Entwicklung der kuhgebundenen Kälberaufzucht in der Öko-Milchviehhaltung Bayerns auf und plädierte für umfangreichen Wissenstransfer sowie den Aufbau von modellhaften Wertschöpfungsketten.
Am Nachmittag wurden einzelne Themen in Workshops vertieft, z. B. warum Milch und Fleisch zusammengehören, wie die Platzierung von Bio-Rindfleischprodukten aus der Milchviehhaltung im Bio-Großhandel gelingt oder wie die kuhgebundene Kälberaufzucht im Deckungsbeitragsrechner berücksichtigt wird. Und ob und inwiefern die Milchleistungsprüfung (MLP) für Betriebe mit kuhgebundener Kälberaufzucht funktionieren kann.
Quelle: Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Kostenfreies Online-Seminar „Staatliche Tierhaltungskennzeichnung verstehen und umsetzen“
Zum 1. August 2024 wird die staatliche Tierhaltungskennzeichnung in Deutschland verpflichtend. Welche Anforderungen sich genau hinter dem Tierhaltungskennzeichnungsgesetz verbergen und wie sich der aktuelle Stand der Umsetzung gestaltet, erläutert ein neues, kostenfreies Live-Online-Seminar der QS-Akademie, auf das wir Sie gern gesondert aufmerksam machen möchten.
Das in Kooperation mit der Initiative Tierwohl (ITW) veranstaltete Online-Seminar „Staatliche Tierhaltungskennzeichnung verstehen und umsetzen“, das am 13. August 2024 (15:00 bis ca. 17:00 Uhr) stattfindet, fasst anschaulich die wichtigsten Kriterien der verschiedenen Haltungsstufen und der daraus resultierenden Pflichten für Tierhalter und Schlachtbetriebe zusammen.
Zusätzlich erfahren die Teilnehmer des Seminars, das sich an Tierhalter und Tierbetreuer schweinehaltender Betriebe sowie an Berater, QS-Bündler und Schlachtbetriebe richtet, in welchen Punkten die staatlichen Anforderungen und privatwirtschaftlichen Haltungsform Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufweisen. Ein Überblick zur Vereinbarung einer Teilnahme an der Initiative Tierwohl (ITW) mit dem Gesetz rundet das Seminar ab.
Quelle: QS Qualität und Sicherheit GmbH
Initiative Tierwohl startet in ihr 10. Jahr: so geht es ab Januar 2025 weiter
* Zukunft der ITW bis mindestens 31. Dezember 2027 gesichert
* Anpassung an staatliche Tierhaltungskennzeichnung ab 2025
* Neue Kriterien in 2025 für Schweine- und Geflügelhalter, Details für Rinderhalter folgen
Die Initiative Tierwohl (ITW) gab heute bekannt, wie sie in das 10. Jahr ihres Bestehens startet. Alle Beteiligten aus Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und Handel haben sich darauf verständigt, wie es ab 2025 weitergeht. Neue ITW-Programme für Schwein und Geflügel sichern den Fortbestand von Deutschlands führender Tierwohlinitiative bis mindestens Ende 2027. Damit leistet die ITW als Brancheninitiative über den 1. Januar 2025 hinaus weiterhin einen entscheidenden Beitrag zur Förderung einer tiergerechteren Fleischerzeugung. Weiterentwicklung und Ergänzung der Kriterien für mehr Tierwohl sind ebenso zentrale Bestandteile der nun unterzeichneten Branchenvereinbarungen wie eine angemessene Aufpreisempfehlung für die Landwirte, die diese Maßnahmen umsetzen. Auch die Fortsetzung des ITW-Programms für Rind soll bald auf den Weg gebracht werden.
Verbesserte Haltungsbedingungen für die Tiere
Ab 2025 passt die ITW ihr Programm an die Anforderungen der Stufe zwei der staatlichen Tierhaltungskennzeichnung „Stall + Platz“ an, die zunächst nur für die Schweinemast gilt. Die Schweine erhalten dann 12,5 statt bisher 10 Prozent mehr Platz im Stall als gesetzlich vorgeschrieben. Außerdem müssen die Tierhalter in jeder Bucht drei Buchtenstrukturierungselemente anbieten. Damit erfüllen ITW-Schweinemäster ab 01.01.2025 die Anforderungen der Haltungsformstufe 2 sowie die der Stufe „Stall + Platz“ des staatlichen Tierhaltungskenn-zeichnungsgesetzes. Darüber hinaus setzen sie zahlreiche weitere Maßnahmen für mehr Tierwohl im Stall um.
Die Hähnchenhalter in der ITW werden ihren Tieren zusätzlich zu diesen bislang geltenden Anforderungen Strukturierungselemente für die Haltungsumwelt anbieten. Für die Putenhaltung gilt diese zusätzliche Anforderung neben weiteren neuen Anforderungen ebenfalls. So müssen u.a. Dämmerlichtphasen wie bereits jetzt in der Hähnchenmast künftig auch bei den Puten, die in geschlossenen Stallungen leben, umgesetzt werden. Außerdem muss auch die Aufzucht von Puten künftig bestehende Tierwohlanforderungen erfüllen. Die neuen Preisempfehlungen für ITW-Mastgeflügel liegen bei 2,97 Cent pro kg für Hähnchen, 3,64 Cent pro kg für Putenhennen und 4,38 Cent pro kg für Putenhähne.
Die neuen Kriterien, die in den Branchenvereinbarungen festgelegt wurden, sind ab 1. Januar 2025 für alle teilnehmenden Schweinehalter, ab 1. Juli 2025 für alle teilnehmenden Geflügelhalter bindend. Auch in der neuen Programmphase wird die Umsetzung in allen Betrieben, die an der ITW teilnehmen, zwei Mal jährlich kontrolliert.
Schließung der Lieferkette bei Schwein
Die ITW hat ein Bonussystem für die Vermarktung von nämlichen Ferkeln eingeführt. Nämlichkeit bedeutet, dass die Tiere von der Geburt bis zur Schlachtung unter ITW-Bedingungen gehalten wurden. Ferkelaufzüchter, die an ITW-Mäster liefern, erhalten ein höheres Tierwohlentgelt im Vergleich zu Aufzüchtern, die an Mäster ohne ITW-Beteiligung liefern. Diese Differenz soll dazu animieren, die Lieferkette von der Geburt bis zur Schlachtung zu schließen. Zudem erhalten die Ferkelaufzüchter bis zum 31. Dezember 2026 das Entgelt weiterhin aus dem sogenannten Ferkelfonds.
Ab dem 1. April 2025 soll die Nämlichkeit zusätzlich durch eine differenzierte Aufpreisempfehlung in der Schweinemast gefördert werden. Mäster, die ausschließlich ITW-Ferkel beziehen, sollen dann einen Aufschlag von 7,50 Euro pro Tier erhalten. Mäster, die zwar die ITW-Standards einhalten, aber die Ferkel nicht von an der ITW teilnehmenden Aufzüchtern beziehen, sollen 6,50 Euro erhalten. Ab dem 1. Januar 2026 wird die letztgenannte Aufpreisempfehlung auf 6,00 Euro sinken.
Ab dem 1. Januar 2027 sollen dann die durchgängige Nämlichkeit erreicht und die gesamte Kette aus Sauenhaltung, Ferkelaufzucht und Mast in eine Marktlösung überführt werden, sodass der Umstellungsfonds für Ferkel entfällt.
Um das Tierwohl der Schweine über Deutschlands Grenzen hinaus zu fördern, die Nämlichkeit in der Breite umzusetzen und zugleich einheitliche Marktbedingungen zu fördern, sollen künftig auch ausländische Ferkelerzeuger und Mäster stärker einbezogen werden.
Sicherung der Nachfrage und ITW-Rind
Mit all diesen Veränderungen strebt die ITW an, auch in Zukunft für mehr Tierwohl zu sorgen. Die wachsende Teilnehmerzahl für das ITW-Programm ab 2025 ermöglicht, dass auch künftig viele Produkte im Lebensmitteleinzelhandel auf mehr Tierwohl umgestellt werden können und die Nachfrage in Richtung Landwirtschaft gesichert bleibt.
Das bereits 2022 gestartete Programm für Rinderhalter soll ebenfalls fortgesetzt werden. An den Rahmenbedingungen arbeitet die ITW derzeit gemeinsam mit den Partnern aus der Wirtschaft. Ziel ist es weiterhin, auch hier mehr Tierwohl für die Breite zu ermöglichen.
Quelle: Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH
Eiweißbilanz: Anteil heimischer Hülsenfrüchte in Futtermitteln fällt um 6,5 Prozent
Das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) hat für das Wirtschaftsjahr 2022/23 sein vorläufiges „Feed Protein Balance Sheet“ für Deutschland veröffentlicht. Rund 2,6 Millionen Tonnen Hülsenfrüchte (ohne Sojabohnen) und Futterleguminosen kamen demnach aus heimischer Produktion. Das verfügbare Gesamtfutteraufkommen ging im Vergleich zum Vorjahr um 30,2 Millionen Tonnen zurück, bei gestiegener Eiweißlücke von 16 Prozent (2021/22: 15 Prozent). Importbedarf bestand nach wie vor an Futtermitteln mit höheren Proteingehalten, wie beispielsweise Soja-Schrot.
Die Verfütterung von heimischen Leguminosen hat nach BZL-Angaben im vergangenen Wirtschaftsjahr leicht abgenommen. Das gilt sowohl für Körnerleguminosen wie Ackerbohnen, Erbse und Lupine, als auch für die Leguminosen zur Ganzpflanzenernte wie Luzerne und Klee.
So ist der Anteil von Hülsenfrüchten (ohne Sojabohnen) und Futterleguminosen am Gesamtfutteraufkommen um 6,5 Prozent auf 2.591.000 Tonnen gesunken (2021/22: 2.771.000 Tonnen).
Schlechtere Grundfutterernte
Insgesamt waren im vergangenen Wirtschaftsjahr mit rund 100,5 Millionen Tonnen Gesamtfutteraufkommen rund 30,2 Millionen Tonnen deutlich weniger Futter in Deutschland verfügbar als im vergangenen Wirtschaftsjahr (2021/22: 130,7 Mio. Tonnen). Der Rückgang ist insbesondere auf eine trockenheitsbedingte schlechtere Grundfutterernte zurückzuführen. Das Inlandsfutter machte mit 96,2 Millionen Tonnen (2021/22: 120,9 Mio. Tonnen) den größten Teil des Gesamtfutteraufkommens in Produktgewicht aus.
Bezogen auf das Produktgewicht hatten Gras und Silomais einen Anteil von 61,5 Prozent am Gesamtfutteraufkommen, inländisch erzeugtes Getreide 23 Prozent, Futterleguminosen einen Anteil von 2,1 Prozent, Hülsenfrüchte und Ölsaaten (inklusive Sojabohnen) kamen zusammen auf 0,6 Prozent. Der Anteil am Gesamtfutteraufkommen von Ölkuchen/Ölschrote lag bei 7,3 Prozent, sonstige Nebenprodukte bei sechs Prozent.
Importe: Sojaschrot an erster Stelle
Insgesamt wurden 4,36 Millionen Tonnen Futtermittel (Produktgewicht) importiert. Das sind zwölf Prozent weniger als im Vorjahr. Von den Importen entfielen 59,9 Prozent auf Sojaschrot, 39,6 Prozent auf Rapsschrot und 15,6 Prozent auf Futtergetreide.
Eiweißlücke steigt bei zurückgegangenem Futteraufkommen
Darüber hinaus zeigt das „Feed Protein Balance Sheet“ auch die sogenannte Eiweißlücke. Sie entspricht dem Anteil des importierten Futters am Gesamtfutteraufkommen, jeweils umgerechnet in den Proteingehalt. Bei den Importen handelt sich hauptsächlich um hochwertige Proteinfuttermittel wie Soja, das überwiegend aus Übersee importiert wird. Die Daten für das Wirtschaftsjahr 2022/23 zeigen: Insgesamt stammen 84 Prozent des Gesamtfutteraufkommens (bezogen auf den Rohproteingehalt) aus dem Inland. Die Eiweißlücke stieg demnach auf 16 Prozent (Vorjahr: 15 Prozent).
Hintergrund
Im „Feed Protein Balance Sheet“ wird das Gesamtfutteraufkommen im Verhältnis zur Gesamtinlandsverwendung jedes Rohstoffes aufgeführt. Damit wird es möglich, die Entwicklungen in der Eiweißversorgung zu verfolgen und die Wichtigkeit einzelner Futtermittel einzuschätzen.
Das vorläufige „Feed Protein Balance Sheet“ für das Wirtschaftsjahr 2022/23 gibt es als Zeitreihe unter www.ble.de/futter.
Quelle: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Online-Erfahrungsaustausch Stockmanship mit Philipp Wenz am 29. August 2024
Sie haben ein Stockmanship-Seminar bei mir besucht, kürzlich oder schon etwas länger her? Manches funktioniert, anderes nicht? Sie interessiert, was Sie ändern können oder wie Kollegen mit solchen Situationen umgehen?
Sie erinnern das ein oder andere Detail Ihrer Schulung nicht mehr und würden sich gerne vergewissern – oder Sie wollen sich einfach mit Kollegen austauschen?
Dafür möchte ich regelmäßig online einen Erfahrungsaustausch anbieten – den Anfang möchte ich mit Ihnen am 29. August 2024 machen.
Anmeldung über https://www.stockmanship.de/#termine oder gruhn@stockmanship.de
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einen Link zum Seminar. Für alle, die bereits an einem/r Seminar/Schulung mit mir teilgenommen haben, ist die Teilnahme kostenlos.
Den Link bekommen Sie als E-Mail, nachdem Sie sich angemeldet haben.
Für alle, die bislang noch nicht teilgenommen haben und neugierig sind, bitten wir um eine Gebühr von 20€ plus MwSt. – Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Rechnung und den Online Link.
Beginn: 19:00 Uhr
Philipp Wenz
Blankenförde 16
17252 Mirow
Coach für effizientes Herdenmanagement
Wirtschaftlichkeitsberatung Mutterkuhbetriebe
www.stockmanship.de
Weitere Informationen hier.
E-Magazin „Der Hoftierarzt“ 3/2024 steht zum kostenfreien Abruf bereit
„Der Hoftierarzt“ Ausgabe 3 / 2024 steht für Sie zum Abruf bereit und bietet folgende Themen:
Themenschwerpunkt Kälber:
• Keinen Tropfen verschwenden: Kolostrum und Transitmilch
• Einfluss Fütterungsmanagement auf Eutergesundheit und Fruchtbarkeit
• Kuhgebundene Kälberaufzucht
• Hitzestress beeinflusst Mikrobiom bei Milchkälbern
• Biomarker für oxidativen Stress bei Kälbern mit Durchfall
Weitere Themen:
• Boehringer Ingelheim: Impfstoff gegen das Blauzungenvirus Serotyp 3
• Lawsonien-Impfung macht Schweinehaltung nachhaltiger
• Animal Health Info System – Digitalisierung Bestandsbetreuung
• Anforderungen an Außenklimaställe für Schweine
• InnoMOO übernimmt Vertrieb von Pectolit® für Deutschland
• Natupig Safety-Linie – Der Weg zum antibiotikafreien Absetzen
• Stetig steigende Ferkelzahlen – Management großer Würfe
• GEA ergänzt mit Übernahme von CattleEye sein Portfolio
• Stallmonitoring mit Kameras von VetVise
• Tierschutz-Probleme in der Haltung von Lamas und Alpakas
• Neue Tierschutzleitlinie für die Schafhaltung
Das Tiergesundheits-Magazin für Nutztierhalter erscheint alle zwei Monate im praktischen PDF-Format. Jetzt 1 x registrieren, 1 x in der Bestätigungs-Mail klicken und dann gleich kostenfrei downloaden und lesen!
Melden Sie sich einfach hier für den kostenfreien Empfang des E-Magazins an. Alle zwei Monate erhalten Sie dann per E-Mail einen Download-Link zur aktuellen Ausgabe.